Die ersten 100 Tage unter Marine Le Pen – „Die Präsidentin“
Ein Comic als Brandbrief? Ja, das funktioniert. In ihrer Graphic Novel „Die Präsidentin“ nutzen der Historiker Francois Durpaire und der Comiczeichner Farid Boudjellal die Realität als dystopische Folie und entwerfen ein Modell, das Frankreich und Europa blühen könnte, sollte Marine Le Pen 2017, ausgestattet mit dem höchsten parlamentarischen Amt qua regulärem Wahlerfolg, im Élysée-Palast regieren.

Francois Durpaire (Szenario), Farid Boudjellal (Zeichnungen): Die Präsidentin. Aus dem Französischen von Edmund Jacoby. Verlag Jacoby & Stuart, Berlin 2016, 160 Seiten. 19,95 Euro
Auch dass die Graphic Novel beim Brexit richtig lag, ist weitaus mehr als zufällig geglückte Prophezeiung: Durpaire arbeitet heraus, dass Demokratien gegen sich selbst ausgehebelt werden können, und die daraus erwachsende rechte Herrschaft droht, sie ein für allemal, nicht bloß für vier Jahre, abzuschaffen.
Dieses alarmierende Urteil können weder die statischen Zeichnungen noch die arg zwanghafte Rahmenhandlung um eine Résistance-Kämpferin und deren Enkelkinder, die als generationenübergreifende Repräsentanten der gegenwärtigen Spannbreite der Linken stellvertretend den Front National über sich ergehen lassen müssen, nivellieren. Ja, selbst ein vorwortender Ulrich Wickert nimmt sich da als gebührend vor sich hinwickerndes Mahnmal aus.
SVEN JACHMANN (ursprünglich erschienen in: Konkret)
Keine Entschuldigungen – „Irmina“
Nach „Gift“, einer Comicerzählung über den berühmten Fall der Serienmörderin Gesche Gottfried, widmet sich Barbara Yelin erneut einem historischen Thema, nicht nur als Zeichnerin, sondern diesmal auch als Autorin. Und abermals verkörpert eine weibliche Protagonistin gesellschaftliche Entwicklungen. Bei des Deutschen Lieblingsthema Nationalsozialismus – Motto: Schuld sind immer die anderen – ist die Fallhöhe erfahrungsgemäß riesig, aber Yelins Graphic Novel ist für derlei Schwachsinn viel zu klug.
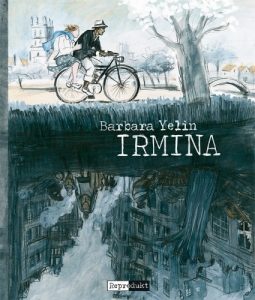
Barbara Yelin (Text und Zeichnungen): „Irmina“.
Reprodukt, Berlin 2014. 288 Seiten. 39 Euro
Das Wiedersehen gerät zur Retrospektive ungenutzter Wahlmöglichkeiten. Howard verehrt nach wie vor Irminas widerständiges Wesen, wie er es in England erlebte; in seiner Familie gilt sie als Legende. In der Kriegerwitwe (als ihr Mann zu ihr sagte: „Irmina, wenn der Krieg gewonnen ist, wird man fragen, wo meine Orden sind“, erwiderte sie: „Du hast recht. Keine Schwäche.“) hingegen rumort, dass sie sich aus opportunistischen Gründen in die Arme der Nazi-Elite schmiegte. Nie würde sie an sich selbst zweifeln, das ahnt sie ebenso wie die LeserInnen, wenn der Krieg einen für die Deutschen annehmlichen Ausgang genommen hätte.
Yelin nutzt keinen Entschuldigungsdiskurs, sondern entwickelt eine intensiv recherchierte, brillant gezeichnete und komponierte Miniaturstudie darüber, wie Mitläufertum ohne ideologische Überzeugung funktioniert. Die Konsequenz: Eine vom Tagesspiegel zusammengestellte Jury kürte „Irmina“ zum Comic des Jahres 2014, 2016 wurde Yelin auf dem Comic-Salon Erlangen mit dem Max-und-Moritz-Preis als „Beste deutschsprachige Künstlerin“ ausgezeichnet.
SVEN JACHMANN (ursprünglich erschienen in: Konkret)
Country Noir – „Im Land der Frühaufsteher“ und „Hühner, Porno, Schlägerei“
Die deutsche Provinz ist ein fremdes Land, in das sich kaum ein Kamerateam, ein Reporter oder ein Maler begibt, ohne positive oder negative Klischees zu reproduzieren: eine Idylle, eine Hölle, immer beides zugleich. Und manchmal nicht einmal das, sondern nur zähe Beharrung bei gleichzeitiger eiliger Zerstörung. Wenn man vom Kapitalismus, von Drogen, von Gewalt und Verwahrlosung in Deutschland erzählen will, dann nicht aus den Metropolen. Dann aus der deutschen Provinz, country noir. Was die Filme, Texte und Bilder sonst nicht mehr vermögen, das können vielleicht Comics, die, was die Darstellung von Tristesse und Unheil anbelangt, unbefangenste und geduldigste Kunstform.
Das Land Sachsen-Anhalt hat für sich einen schön zwiespältigen, beinahe schon Grauen erregenden Slogan gewählt: „Wir stehen früher auf“, behauptet die Imagekampagne des Landes, und so wurde dies das „Im Land der Frühaufsteher“. In dieses freudlose Land führt die graphische Erzählung von Paula Bulling, eine Comic-Geschichte in Ich-Form, bewusst skizzenhaft, bewusst subjektiv, bewusst selbstreflexiv. Die Bild-Geschichte „Im Land der Frühaufsteher“ geht auf viele Begegnungen und Gespräche mit Asylbewerbern zurück, die die Autorin in Halle, Halberstadt oder Möhlau hatte. Sachsen-Anhalt mag eine besonders restriktive Flüchtlingspolitik betreiben, doch so oder so ähnlich sind die Verhältnisse in ganz Deutschland.

Paula Bulling (Text und Zeichnungen): „Im Land der Frühaufsteher“.
Avant-Verlag, Berlin 2012. 125 Seiten. 17,95 Euro
Paula Bulling ist klar, dass sie die Perspektive dieser Menschen, deren „Vergehen“ darin besteht, überhaupt da zu sein, nicht wirklich einnehmen kann. Während die Asylbewerber in ihren Unterkünften, die sich vom Knast nur durch ihre Verwahrlosung unterscheiden, bleiben müssen, kann sie nach ihrer Recherche wieder zurückkehren in die Freiheit und die Bequemlichkeit.
Aus ihrer Recherche entsprang ein ausgesprochen skrupulöses Vorgehen. Sie ließ zum Beispiel die Texte ihrer Sprechblasen von Ko-Autoren wie dem aus Burkina-Faso stammenden Noel Kaboré bearbeiten, der den Blickwinkel von Flüchtlingen persönlich kennt und diese vor Ort auch berät. Sehr genau beschreibt sie ein Leben mit Essensgutscheinen, Arbeitsverbot und Bewegungseinschränkung, in dem der Besitz eines Fernsehapparates ein Privileg bedeutet, das mit dem Verlust der Privatsphäre bezahlt wird.
Es ist die Geschichte einer Annäherung und des Versuchs einer Solidarisierung. Die Reise beginnt damit, dass Paula und ihre Freundin eine dreiviertel Stunde durch den Wald radeln müssen, um zum Heim zu gelangen. Wenn Aziz, Fatma und die anderen Asylbewerber die Isolation ihrer Unterkunft verlassen wollen, dann müssen sie mehr als eine Stunde Fußweg auf sich nehmen. Um was zu finden, im Land der Frühaufsteher? Auf allen Wegen begleitet sie die Angst vor rassistischen Übergriffen und vor der deutschen Bürokratie, die mit der Abschiebung droht. Eine Ahnung davon bekommt die Autorin bei ihren Besuchen im „Asylantenheim“, es gibt Ausweiskontrollen, Diskriminierungen, Besucherzettel. Allein der Kontakt zu den ausgegrenzten Menschen in den Heimen macht sie verdächtig.
Es sind harte, kräftige und nicht korrigierte Striche, es ist ein grundlegend tristes Dunkelblau, in dem die Zeichnerin kaum einen Trost, keine falsche Harmonie, keine Überhöhung zulässt. Paula Bulling argumentiert in ihrer Bilderzählung nicht, sie sieht nur genauer hin, als wir das gewöhnlich tun. Sie muss zeichnerisch einen Kontakt zwischen zwei Lebenswelten herstellen, den es in der Wirklichkeit kaum gibt.
„Die Unterbringung von Flüchtlingen soll ihre Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland fördern“ – so zynisch und offen wie in der Bayerischen Asyldurchführungsverordnung wird die unmenschliche Behandlung zwar nur selten beschrieben, doch es ist, so scheint es, sowohl offizielle Politik als auch gesellschaftlicher Konsens, Menschen, die „lästig“ sind, absichtlich zu demütigen und ihnen alle Grundrechte zu nehmen, ganz einfach um sie loszuwerden.
Die sieben Kapitel der Erzählung in Bildern folgen keinem dramaturgischen Kniff; vielmehr geht es darum, den in der deutschen Provinz ausgegrenzten Menschen eine Stimme zu geben, nein, mehrere Stimmen. Dass sie mit dem Tod eines Flüchtlings endet, ist nicht Dramaturgie. Sondern deutsche Wirklichkeit. Die Reise endet mit dem ungeklärten Tod des Flüchtlings Azad Murat Hadji. An der Aufklärung scheint die deutsche Justiz so wenig interessiert wie die Öffentlichkeit. Doch die allerletzte Szene zeigt Farid, Paula und Hadjis Frau Kristina mit den zwei in Deutschland geborenen Töchtern. Die Abschiebung der Familie konnte in letzter Minute verhindert werden. Man kann etwas tun, es liegt an uns.

Sophia Martineck (Text und Zeichnungen): „Hühner, Porno, Schlägerei – Deutsche Dorfgeschichten.“
Avant-Verlag, Berlin 2012. 52 Seiten. 14,95 Euro
Die Autorin beschreibt ihren eigenen Weg in eine verborgene Welt, die sie mit der Hilfe der Flüchtlingsorganisation The Voice fand. Diese half beim Zugang zum Heim Katzhütte in Thüringen, wo Paula Bulling den aus Nigeria stammenden Filmemacher Maman Salissou Oumarou (der an Filmen wie „Oury Jalloh“ beteiligt war) kennenlernte, der selber im Asylverfahren steckte und sehr genau wusste, was dort geschah. Mit ihm arbeitet sie bereits an weiteren Projekten, darunter ein Album mit dem Titel „Youssouf“, die Geschichte eines jungen Nigerianers, der wie so viele andere dem Traum von der Flucht in einen Teil der Welt folgt, in der es, vielleicht, weniger Gewalt, weniger Hunger, weniger Hoffnungslosigkeit gibt.
Einen ganz anderen, aber dann auch nicht weniger radikalen Blick auf die deutsche Provinz wirft Sophia Martineck in ihrem Buch „Hühner, Porno, Schlägerei – Deutsche Dorfgeschichten", der ebenso autobiographisch grundiert ist. Die Geschichte führt in ein trostloses, sterbendes Dorf namens Niederböhna, das nicht zuletzt deshalb so furchtbar wirkt, weil es Erinnerungen an durchaus Schönes bewahrt. Martineck zeichnet im Stil „naiver“ Kinderbücher (einschließlich großformatiger Ausklapptafeln), und das macht das Grauen, das hier lauert, nur noch drastischer.
Dieses Niederböhna, das es nicht gibt, weil es so viele davon gibt, ist ein typisches deutsches Dorf unserer Tage. Es liegt in einer sanften Landschaft mit Hügeln und Seen, die Landwirtschaft ernährt nur noch wenige, das Dorf ist stattdessen Schlafstadt für Menschen, die in der Stadt arbeiten, wenn es Arbeit gibt. Die lakonisch-höllischen Geschichten, die Sophia Martineck aus Niederböhna erzählt, von absurden Geschäften, Ausbrüchen von Gewalt, Bigotterie und Obszönität sind alle der deutschen Wirklichkeit, den Lokalzeitungen und den provinziellen Legenden entnommen. Symptome einer sozialen und ethischen Entwurzelung, pathetisch gesagt: das Kaputtmachen von Heimat. Das scheinbar naive Bild bricht sich oft an dem drastisch-nüchternen Text; was daraus entsteht ist indes mehr als eine satirische Text/Bild-Schere: Es bezeichnet wahrhaft die Falle, aus der man hier nicht mehr heraus kommt. Eine doppelte Begrenzung, gefangen im Alten und im Neuen, in der Provinz des Landes und in der des Internet, zum Beispiel. Die Sprache trifft sehr genau den Jive der entsetzten Nachbarlichkeit: „So etwas kennen wir nur aus der Zeitung: Die Herzogs waren immer sehr nette Leute gewesen. Sie haben zwei Jungs gehabt, auch die Großmutter lebte mit im Haus. Der Garten und das Haus waren immer sehr gepflegt gewesen. Auch im Haus deutete alles auf ordentliche Verhältnisse hin. Und dann sowas, hier bei uns.“ Durch das, was da gerade verloren geht, bleibt das Verlorene im kindlichen Strich und den wunderbaren „Buntstift“-Farben sichtbar, und durch die idyllisch-naivste Zeichnung schillert das Grauen. Country noir.
Man muss vielleicht die beiden graphischen Erzählungen, eher Sozialreportagen mit dem Zeichenstift als das, was man modisch gern „Graphic Novel“ nennt (wohl um das vulgäre Wort „Comic“ zu vermeiden), aneinander legen, um ein Bild der deutschen Provinz im Jahr 2012 zu bekommen. Wie können Menschen anderen Menschen Heimat anbieten, wenn sie doch ihre eigene selber gerade zerstören? Weil sie Kriege gegeneinander führen wegen eines Taubenschlags, weil sie jede kleinste Abweichung verachten, weil sie nicht mehr wer sein können, ohne es auf Kosten der anderen zu sein.
Beiden Arbeiten gemeinsam ist, dass die Autorinnen ganz und gar ohne Überheblichkeit, Besserwisserei und Appellation auskommen. Graphische Reportage, Soziologie mit dem Zeichenstift, wie immer man dieses immer noch neue Genre nennen mag, es ist eine künstlerische Geste gegen die Blindheit im eigenen Alltag. Die Wiedergeburt des politischen Comic aus dem Geist der teilnehmenden Beobachtung.
GEORG SEESSLEN (ursprünglich erschienen in: Jungle World)
Rechtsextremismus im Ruhrgebiet – „Drei Steine“

Nils Oskamp (Text und Zeichnungen): „Drei Steine“.
Panini, Stuttgart 2016. 160 Seiten. 19,99 Euro
Dem Comic-Künstler Nils Oskamp ist das keinesfalls entgangen. Anfang der Achtzigerjahre besucht er eine Realschule in Dortmund und stellt sich dort rechtsradikalen Klassenkameraden entgegen, die unter dem Schutz einiger „traditionsbewusster“ Lehrer die Hassparolen der 1995 verbotenen Partei FAP an ihre Mitschüler herantragen. Schnell wird der Jungendliche das Ziel gewalttätiger Übergriffe und gezielten Mobbings. Weder seine überforderten Eltern noch die Polizei scheinen ihn vor dem immer weiter eskalierenden Spießrutenlauf schützen zu wollen.
Die 160 Seiten starke Graphic Novel rekapituliert dieses bedrückende Kapitel im Leben des Comic-Künstlers, dem letzten Endes nur sein Freund Thomas gegen die Nazis zur Seite steht.
MATTHIAS PENKERT-HENNING (ursprünglich erschienen auf Comic.de)
Zerrbild des reaktionären Bürgertums – „Blotch. Der König von Paris“
Blotch ist der selbst ernannte Liebhaber alles Schönen. Aber eigentlich ist er bloß das karikaturesk nicht sonderlich verfremdete Zerrbild des reaktionären Bürgertums. Blotch ist auch der selbst ernannte Rubens der Neuzeit. Aber eigentlich ist er das Alter Ego seines Schöpfers Christian Hincker, besser bekannt als Blutch, international gefeierter Comicautor und Erzähltausendsassa aus Frankreich. Genauer gesagt ist Blotch das antizipierte Bildnis dessen, was Blutch die größte Sorge bereitet: „Mit Blotch exorziere ich das, wovor ich mich am meisten fürchte: Routine und Verbitterung.“
Blotch ist seines Zeichens Karikaturist des fiktiven, konservativen Pariser Witzblättchens Fluide Glacial, eine Parodie jener gleichnamigen realen wie renommierten Satirezeitschrift, in der die jeweils fünf Seiten umfassenden abgeschlossenen, aber durchaus aufeinander Bezug nehmenden Kurzgeschichten ursprünglich veröffentlicht wurden. Nun im Jahre 1936 angesiedelt, wird es in seiner ausgestellten Biederkeit zur ideologischen Vorhut der Vichy-Regierung, zum Tummelplatz für selbstverliebte und gleichsam talentfreie Künstlerexistenzen, die, zumindest den Namen nach, den realen Mitarbeitern unschwer erkennbar nachempfunden sind: Aus Goossens wird Goussein und in seiner Reihe „Der alltägliche Kampf“ greift Manu Larcenet selbst hin und wieder auf die hier verwendete Variante „Larssinet“ zurück.

Blutch (Text und Zeichnungen): „Blotch. Der König von Paris“.
Aus dem Französischen von Kai Wilksen. Avant Verlag, Berlin 2009. 104 Seiten, 17,95 Euro
Dafür ist ihm nur jedes Mittel recht: Will er eine Frau beeindrucken, gibt er sich schon mal notgedrungen als sein Erzfeind Jean Bonnot aus, nur um folgend in einen Lobgesang zu verfallen, in dem er das Talent seines großen Vorbilds, Blotch, preist; einem nervösen Redaktionsneuling klaut er schamlos dessen Ideen, nachdem er ihm jeden Anflug von Mut ausgeredet hat, und die Ermordung des berühmten Schriftstellers Saint-Chamoux ist vor allem Anlass, dessen letzte Worte, freilich umgemünzt, im Presseinterview der Nachwelt zu verkünden: „Seien sie gewiss, Blotch, wenn ich die Stimme Frankreichs bin, so sind Sie das Herz!“ Dass dessen Tod erst durch Blotchs unterlassene Hilfeleistung eintreten konnte, bleibt indes sein Geheimnis.
Auch wenn sich hierin die dunkle Kehrseite des Autors, die Angst vor der drohenden Selbstgefälligkeit, artikulieren mag, ist Blotch doch zugleich die Abrechnung mit dem wohl nie versiegenden Genie- und Personenkult des Kunst- und Comicmarkts. Davon bleiben auch die Paratexte nicht unberührt: Auf der letzten Seite verfällt die Prominenz von André Gide über François Mitterrand bis Pablo Picasso der Huldigung jenes Meisters, von dessen Verkommenheit wir zuvor ausgiebig Zeugen werden durften. Das ficht nicht zuletzt den Glauben an die sittliche Wirkung der schönen Künste an (die zu produzieren Blotch ohnehin nicht in der Lage ist), insbesondere angesichts eines historischen Rahmens, der unmittelbar auf die vollkommene moralische Kapitulation des Bürgertums zusteuert.
Der schwarz-weiße, die Konturen immer wieder variierende Strich und das Formspiel der Schraffuren, die als Hintergründe die Figuren manchmal regelrecht zu verschlingen drohen, ist dann auch Hommage an die Illustrationskultur der 30er-Jahre. Wenn Blutch jedoch ausgerechnet Frans Masereel zitiert, Blotchs wohl größtdenkbaren Antipoden, bleibt auch die Hommage gleichzeitige Selbstanklage. Wenn das Resultat zu solch wundervoll hassenswerten Figuren führt, beruhigt indes die Gewissheit: Wo Blotch ist, wird Blutch bleiben.
SVEN JACHMANN (ursprünglich erschienen in: taz)
Donald Trump als orange Masse, Bill Clinton als Waffel – „Trump! Eine amerikanische Dramödie“
Schon im September 1987, als Donald Trump das erste Mal in den „Doonesbury“-Cartoons auftaucht, geht es um seine Kandidatur als amerikanischer Präsident: „Würde ich kandidieren, dann als Original, als ein liebgewordener Archetyp: der amerikanische Vermieter!“
Die Cartoons von G. B. Trudeau gelten in den USA als Seismograf für das politische Leben, Trudeau war einer der ersten, der die Wahl von Barack Obama zum amerikanischen Präsidenten vorhersagte. Mit den Trump-Auftritten in seinen Cartoons hat er schon vor 30 Jahren deutlich gemacht, was diesen hemdsärmeligen Geschäftsmann auszeichnet: Instinkt für gelungene Medieninszenierungen. Tatsächlich wird seine Spekulation über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur von der Presse im Comic mit Elan aufgegriffen. Seine Verachtung für die Schwachen, die er als Vermieter ohne Skrupel auf die Straße wirft und sein größenwahnsinniger Machthunger – denn Donald Trump spekuliert ohne jede politische Erfahrung auf das Amt des Präsidenten:
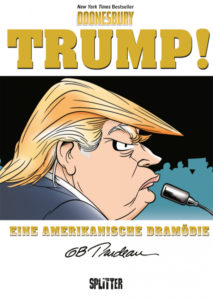
Garry Trudeau (Text und Zeichnungen): „Trump. eine amerikanische Dramödie“.
Aus dem amerikanischen Englisch von Gerlinde Althoff. Splitter, Bielefeld 2017. 112 Seiten. 18,80 Euro
Je weiter man diesen Cartoonband „Trump – Eine amerikanische Dramödie“ liest, desto folgerichtiger scheint Trumps Wahlsieg am Ende zu sein. Ein Größenwahnsinniger, der mit Ignoranz und wüsten Rüpeleien jede Niederlage wegsteckt und alles niedermacht, was ihm im Weg steht. Dieses Motiv variiert der Cartoonist Trudeau immer wieder.
Warum aber wird das nicht langweilig? Und warum galt Trumps Wahlsieg bis zuletzt als unwahrscheinlich – schließlich erscheinen die Cartoons in den USA in rund 900 Zeitungen und erreichen ein Millionenpublikum. Letzteres lässt sich leicht beantworten. Denn der Cartoonband ist ein Konzentrat aller Trump Auftritte im „Doonesbury“-Universum. Tatsächlich liegen manchmal Monate, mitunter auch Jahre zwischen den einzelnen Pointen. „Solange ich Kandidat bin, müssen sie über mich schreiben. Das ist gut für die Marke Trump, die größer und größer und größer wird.“
Dazu hat der Cartoonist auch noch zahllose Nebenfiguren erfunden: Kriegsveteranen und Starlets, Karrieristen, Kiffer und Menschen unterschiedlichster sozialer Herkunft, die immer alles richtig machen wollen. Genau das macht diese Trump-Cartoon-Sammlung so kurzweilig: Neben Trump sind die Nebenfiguren mit ihren lakonischen Anmerkungen oft ein Gegenwicht. Und ganz nebenbei zeigt Trudeau auch noch, wie Trump so erfolgreich werden konnte: Alle, Gegner wie Fans haben nicht nur seine Castingshow „The Apprentice“ im Fernsehen gesehen – sondern auch jede Provokation im Wahlkampf diskutiert, sodass die Argumente der anderen Kandidaten gnadenlos untergingen.
„Sorry ihr Loser und Hasser, aber mein IQ ist der höchste!“ Trudeau spielt in seinen Cartoons immer wieder mit Trump-Zitaten. Das ist amüsant und gruselig zugleich – und eine großartige Trump-Satire in Echtzeit.
ANDREA HEINZE (ursprünglich erschienen in: Deutschlandfunk)
Sieben Tage Warschau – „Das Erbe“
Comics definierten einst eine kulturelle Grenze. Zwischen Kindheit und Jugend, zwischen Pop und Kunst, zwischen Underground und Mainstream, zwischen niedrig und hoch, zwischen naiv und kompliziert. Auch der Unterschied zwischen Comic-affinen und dem Genre feindlichen Kulturen wie der deutschen war früher einmal gewaltig. Mittlerweile sind Comics eine lingua franca geworden. Das Medium hat etwas von seiner Massenwirksamkeit an neue elektronische Formen von Unterhaltung und Information abgegeben; ökonomisch erlebt es eher eine Krise als einen Boom. Aber zur selben Zeit ist es auch erwachsen geworden. Die zeitaufwendige, subjektive und handwerkliche Produktionsweise wirkt verlässlicher und ehrlicher als die Echtzeit- und Netz-Informationen und scheint insbesondere geeignet, heikle Themen, dissidente Perspektiven und biographische Gesten aufzugreifen. Seit Art Spiegelmans „Maus“ wissen wir, dass auch das geht: vom großen Menschheitsbruch, vom Holocaust, in Comic-Form zu erzählen. Wie und warum es möglich ist, das machte Spiegelman zugleich zu einem Thema, weil das Genre eine Form des Distanzierens, sogar der Maskerade erlaubt, in der man seinem Gegenstand näher kommen kann, als es die Literatur, der Film, die Malerei, die Fotografie, die Reportage und das Tagebuch erlauben. So verwundert es nicht einmal, dass in der Welt von Handy-Fotografie und Bilder-Blogs das Genre der Comic-Reportage gedeiht. Und schon gar nicht, dass man sich in diesem Medium den Geistern der Vergangenheit widmen kann, eine besondere Form des graphischen Reenactment. Annäherung durch Stilisierung.
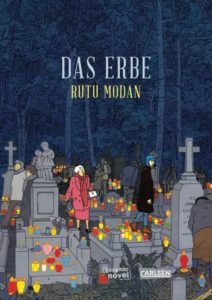
Rutu Modan (Text und Zeichnungen): „Das Erbe“.
Aus dem Hebräischen von Gundula Schiffer. Carlsen Verlag, Hamburg 2013. 240 Seiten. 24,90 Euro
All diese Vorzüge einer nun auch nicht mehr wirklich brandneuen Erzählweise scheinen in „Das Erbe“ von der israelischen Zeichnerin und Kinderbuchautorin Rutu Modan so perfekt vereint, dass man sich nicht wundert, dass diese Bildgeschichte zu einem veritablen Klassiker des Genres geworden ist. Man kann hier studieren, was die zugleich so altmodische und hochaktuelle Kunst des Comic-Genres zu bieten hat.
„Das Erbe“ ist zunächst ein Reiseroman, der von Tel Aviv nach Warschau führt. Die Großmutter der Heldin, Regina Segal, beschließt, nach dem Tod ihres Sohnes in ihre Geburtsstadt Warschau zu reisen, um dort ein Familienerbe einzuklagen, das im Zweiten Weltkrieg verloren wurde. Die alte Dame fühlt sich dabei hin- und hergerissen und ist deshalb keinesfalls bereit, ihrer Enkelin Mica alles über ihre Vergangenheit zu erzählen. Nach und nach erfährt Mica die wahren Gründe für diese Reise, aber zur selben Zeit scheinen sich auch andere Leute für Regina Segal und ihre Ansprüche zu interessieren.
So legt sich über diese einfache Geschichte ein Hauch von Mystery und Thrill. Gewiss trägt die Geschichte autobiographische Züge, insbesondere die Gestalt der „schwierigen“ Großmutter wirkt nicht so, als könne man sie sich so einfach ausdenken; aber insgesamt ist es doch eine fiktive Geschichte. Eine Liebesgeschichte gibt es ebenfalls, dazu die Selbstreflexion des Mediums durch den Auftritt eines Comic-Zeichners, der in seinen Zeichnungen vielleicht zu viel vom Familiengeheimnis verrät. Spannend bis zum dann doch überraschenden Ende ist die Geschichte allemal. Denn Regina Segal wollte nie wirklich ein Erbe antreten, sie hatte vielmehr eine Botschaft zu überbringen. Aber was diese Geschichte wirklich aufregend macht, ist der genaue, leicht humorvolle Blick auf ein Leben, das seine letzten Geheimnisse nicht preisgeben kann. Zudem findet die Autorin wundervolle Bilder für das Nebeneinander vom alten und neuen Warschau. Dort bekommt die Graphic Novel auch Züge einer Comic-Reportage. Denn das Ausgangsmaterial für die Geschichte bietet die neugierige und gezielte Reise der Autorin nach Polen, das die Großmutter nur das „Land der Toten“ nannte und das eine komplizierte Einheit von Grauen und Nostalgie bildete. Nur im Comic kann man so genau beschreiben, wie Orte aus Realität, Erinnerung und Traum zusammengesetzt sind. Man sieht einen Platz, wie der tschechische Schriftsteller Bohumil Hrabal sagte, nur wirklich, wenn man auch sieht, was nicht mehr zu sehen ist.
Es sind die vielen nebensächlichen Beobachtungen, die das Buch so reich machen. Das beginnt am Ben-Gurion-Flughafen, wo sich die Großmutter standhaft weigert, eine Flasche Wasser wegzuwerfen, nur weil das uneinsichtige Wachpersonal aus Sicherheitsgründen nicht zulassen will, dass sie sie mit ins Flugzeug nimmt. An Bord begegnet man nicht nur ausgelassenen Schülern auf dem Weg zum Gruppenbesuch in Warschau. Auch ein sonderbarer Bekannter drängt sich den beiden Frauen auf. Zu trauen ist ihm nicht. Aber ein wirklicher Schurke ist er auch nicht. Selbst die Verpflegung an Bord des Fluges von Tel Aviv nach Warschau ist Gegenstand der detaillierten Darstellung. Man nennt das wohl eine „verschärfte Wahrnehmung“.

Rutu Modan, 1966 in Tel Aviv geboren, benutzt die Stilform der ligne claire, nicht nur in der Zeichnung selber, sondern auch im dramaturgischen Aufbau. Es gibt pointierte Episoden, stumme Passagen, Panel-Folgen, die mit wenigen Perspektivwechseln eine Kamerabewegung imitieren, und eine klare Anordnung der Panels auf einer Seite. Die Nähe zu Hergé fällt auf den ersten Blick auf. Der graphische „Hergéismus“ prägt auch Modans frühere Arbeiten, die allesamt sehr nahe an der heutigen Wirklichkeit Israels und, wie ihr Comic „Mixed Emotions“, auch autobiographisch geprägt sind. Darin hält die Autorin ihre erste Reise nach New York und ihre Schwangerschaft in Bildern fest. „The Murder of the Terminal Patient“ ist ein Ausflug in den Mystery-Thriller, erdacht als wöchentliche Folge für das Magazin der New York Times. In ihrer zweiten Graphic Novel „Das Erbe“ beschäftigt Modan sich mit ihrer eigenen Familiengeschichte. Sie liefert keine akkurate autobiographische Beschreibung, sondern geht assoziativ mit dem Erinnerten um.
Wie schon in der Bilderzählung „Exit Wounds“, die in deutscher Übersetzung unter dem Titel „Blutspuren“ erschienen ist, arbeitet die Autorin mit einer sehr eigenen Technik des Acting-Painting: Sie lässt Schauspieler die Vorlagen für die Zeichnungen „spielen“, um eine genaue Vorstellung von einer stimmigen Bewegungsmelodie und der je eigenen Körpersprache der Figur zu bekommen. Einige dieser menschlichen Vorbilder sind bekannte israelische Schauspieler, die in gewisser Weise zu Mitautoren geworden sind und dazu beitragen, dass wir ein sehr lebendiges und durchkomponiertes Geschehen erleben. Die fotografische Matrix sorgt für eine anatomische und typologische Fehlerlosigkeit, die mit der graphischen Vereinfachung einen sonderbaren Kontrast bildet – als bliebe eben wirklich nur das Wesentliche. Aus einem Drehbuch wurde ein Storyboard und daraus wurde wiederum ein Set von filmischen Fotografien, die im letzten Produktionsschritt in den ligne claire-Comic übersetzt werden, den wir vor uns haben.
Comic-Produktionen dieser Art sind erheblich aufwendiger als die gewohnten, sie setzen sich aus zahlreichen Produktionsschritten, aus Reisen, Skizzen und Recherchen, zusammen und können sich am Ende nur amortisieren, wenn sie einen internationalen Markt erschließen. Das kann sich, wie im vorliegenden Fall, als Glücksfall erweisen, es ist allerdings auch eine Gefahr. Die Gestalten sind nicht mehr wirklich und allein aus dem Strich des Zeichners geboren, der Comic wird zum arbeitsteiligen Großprojekt. Aber eben auch zu einem multiinstrumentalen Projekt, oder sagen wir es anders: zur modernen Kunst.
„Das Erbe“ ist eine wichtige Ergänzung zu Art Spiegelmans „Maus“, eine Spiegelung, wenn man so will. Der Schwerpunkt der Geschichte liegt auf der Gegenwart, in die die Vergangenheit hineinragt. Der Ausgangskonflikt greift ein aktuelles gesellschaftliches Problem auf. Es geht um die Furcht vieler älterer und ärmerer Leute in Warschau vor der Vertreibung aus ihren Häusern durch die früheren Besitzer. Dieser Grundkonflikt von „Das Erbe“ ist dementsprechend unlösbar, es gibt keine gerechte Lösung, nur eine menschliche. Zweifellos ist der Grundton dieser Graphic Novel bei allen Seitenaspekten und Konflikten eher versöhnlich, sogar der Friedhof ist hier ein freundlicher Ort. Aber umgekehrt scheint alles Komische, was immer wieder aufscheint, nur das Vorspiel zur großen Tragödie: Das Komische funktioniert hier nicht im Sinne einer Entlastung, sondern macht gerade die Absurditäten der Geschichte deutlich. Etwa wenn Mica, die als Nahkampfausbilderin bei der Armee tätig war, was so ganz im Widerspruch zu ihrem eher zarten Äußeren zu stehen scheint, den kampfsportbegeisterten Sohn des polnischen Rechtsanwalts in einem Fight um eine Mohrrübe für sich einnimmt. Oder wenn ein eifriger junger Mann das berühmte Fotoplastikon von Warschau bedient, indem er immer wieder buchstäblich in die große Bildermaschine hineinkriechen muss, um die Bilder der Vergangenheit zu projizieren.
Das Erbe ist eigentlich nur ein Haus, viel weniger, als es die Nebenfiguren des Dramas erwarteten, und dieses Erbe anzutreten, würde anderen Kummer bereiten. Zudem ist da auch noch die Erinnerung an die große Liebe von Regina und Roman, die in den kräftig-zartesten Farben beschworen wird, die sich abseits des Kitsches auf der Palette befinden. Es geht um die Erinnerung, die zwischen den Romanen der Täter und den Romanen der Opfer verlorenging.
In ihrer Familie, sagt die Autorin, sei nie über den Holocaust und die europäische Vergangenheit gesprochen worden. Die Kids in „Das Erbe“ streiten sich darum, welches das heftigere Konzentrationslager war, Mica gerät in ein groteskes „Reenactment“ des Kampfes um das Warschauer Ghetto, ein Lehrer erklärt, während er ein Flugzeugmenü verspeist, wie wichtig es für die Schüler sei, von „Überlebenden“ an die Stätten der Vernichtung geführt zu werden: „Okay, Montag Treblinka, Dienstag Majdanek, inklusive Gaskammern… Majdanek steckt Auschwitz in die Tasche. Ist viel grausiger.“ Beim historischen Rollenspiel steigert sich ein junger Mann allzu sehr in die Rolle eines SS-Mannes beim Abtransport der durch den „Judenstern“ gekennzeichneten Mitspieler. Es ist ein durchaus kritischer Blick auf die „Erinnerungskultur“ hier wie dort, der in „Das Erbe“ zu teilen ist. Und ein Beispiel dafür, wie man es anders, wie man es besser macht.
GEORG SEESSLEN (ursprünglich erschienen in: Jungle World)
In deutscher Hand – „Auf den Spuren Rogers“ und „Ich, René Tardi, Kriegsgefangener im Stalag IIB“
„Ich verkrampfte mich jedes Mal, wenn ich einen Deutschen sah, und verachtete mich dafür, wenn mein Herz beim Anblick deutscher Verwundeter unfreiwillig weich wurde“, schildert Lee Miller ihre Gefühle gegenüber den Deutschen in einer ihrer beeindruckenden Kriegsreportagen, die erstmals in deutscher Übersetzung in dem Sammelband „Krieg. Mit den Alliierten in Europa 1944–1945“ in der Edition Tiamat erschienen sind. Als eine der wenigen Kriegskorrespondenten erlebte Miller die Befreiung Frankreichs mit, sie schrieb für die amerikanische Zeitschrift Vogue über die Zustände in Feldlazaretten und über die Stimmung nach dem Ende der Besatzung von Paris. Sie zog mit den alliierten Truppen weiter in Richtung Deutschland und verfasste dort Reportagen über die Befreiung der Konzentrationslager, über Selbstmorde von NS-Funktionären und die Scheinheiligkeit der deutschen Bevölkerung: „Wie wollen sie sich von allem, was war, distanzieren? Welche Verdrängungsleistung in ihren schlecht belüfteten Hirnwindungen bringt sie zu der Vorstellung, sie seien ein befreites Volk und kein besiegtes?“ Immer wieder begegnete sie auch befreiten Kriegsgefangenen, die, wie Miller schreibt, hungrig durch die Städte zogen. In „Krieg“ heißt es über die deutschen „Stalags“, die Kriegsgefangenenlager: „Aus allen Berichten geht hervor, dass die englischen Gefangenen am besten behandelt wurden, die Amerikaner am schlechtesten, die Franzosen und alle anderen Nationalitäten irgendwo dazwischen.“ Dieser Eindruck – niedergeschrieben in den unmittelbaren Nachkriegswirren im Frühsommer 1945 – deckt sich nur zum Teil mit der Realität. Am schlechtesten ging es wohl den sowjetischen Kriegsgefangenen, von denen 35 Prozent, über eine Million Soldaten, die Gefangenschaft nicht überlebten.

Jacques Tardi (Text und Zeichnungen): „Ich, René Tardi, Kriegsgefangener im Stalag IIB“.
Aus dem Französischen von Christoph Schuler. Edition Moderne, Zürich 2013. 200 Seiten. 35 Euro
Einer, der seine Erlebnisse mit sich selbst ausmachte, war auch der ehemalige Kriegsgefangene Roger Brelet. Sein Enkelsohn Florent Silloray, ein bekannter Kinderbuchillustrator, hat zum selben Zeitpunkt wie Tardi in Frankreich eine Graphic Novel über das Drama der Kriegsgefangenschaft veröffentlicht. Sein Comic-Debüt trägt den Titel „Auf den Spuren Rogers“. Sein Großvater Roger, ein Landwirt, wurde am 2. September 1939 zum Kriegsdienst eingezogen, Tardis Vater René war 1935 Berufssoldat geworden, „um Hitler die Stirn zu bieten“. Die Aufzeichnungen des Vaters beziehungsweise des Großvaters waren das Ausgangsmaterial für die Comics.

Florent Silloray (Text und Zeichnungen): „Auf den Spuren Rogers“. Aus dem Französischen von Volker Zimmermann. Avant Verlag, Berlin 2013. 112 Seiten. 24,95 Euro
Nicht nur die Beschreibungen des Elends in den deutschen Kriegsgefangenenlagern sind erschütternd, sondern auch der Umstand, dass das Schweigen über dieses Kapitel der Geschichte erst posthum durch die Nachkommen der Soldaten gebrochen wurde. Ähnlich war es auch im Fall Lee Millers, die nach Beendigung ihrer Arbeit in den Reihen der Alliierten niemals mit ihrer Familie über ihre Erlebnisse als Kriegskorrespondentin gesprochen hat. Erst nach ihrem Tod kümmerte sich ihr Sohn um die nachgelassenen Reportagen und Fotos.
Tardi und Silloray setzen ihrem Vater beziehungsweise Großvater stellvertretend für eine ganze Generation, die verzweifelt Widerstand gegen die Wehrmacht leistete, ein Denkmal. Jacques Tardi stützt sich auf die Erinnerungen des Vaters, die er aus der zeitlichen Distanz von 40 Jahren auf Bitten des Sohnes festgehalten hat; Florent Silloray auf die nach dem Tod des Großvaters gefundenen Tagebücher und Fotos aus dem Kriegsgefangenenlager „Stalag IV B“. Fragen konnte er seinen Großvater nicht mehr. Auch für Tardi blieben nach dem Tod des Vaters viele Fragen offen. Beide Comics sind geprägt vom Widerspruch zwischen der Nähe zum Protagonisten und dem distanzierten Blick auf das Geschehen, das nur vermittels der nachgelassenen Aufzeichnungen rekonstruiert werden kann. Diese Ambivalenz findet in den Comics ihren je eigenen Ausdruck. So hat sich Jacques Tardi in „Ich, René Tardi, Kriegsgefangener im Stalag II B“ selbst als Figur in den Comic eingeschrieben. Er übernimmt die Rolle des Jungen, der den Vater begleitet und ihn nach seinen Gefühlen befragt. Sie diskutieren und streiten, neben den beiden kommt im gesamten Comic keine andere Figur zu Wort. Es sind die Bilder, die die Geschichten erzählen.
In Sillorays „Auf den Spuren Rogers“ reihen sich die Panels wie in einem Fotoalbum aneinander; alte, vergilbte Bilder wechseln mit farbig gezeichneten Episoden. Es sind zwei Zeitebenen und zwei Perspektiven auf die Familiengeschichte: „Während meiner gesamten Kindheit hat mir Opa nie vom Krieg erzählt, in keinem der langen Momente, die ich mit ihm verbringen durfte.“ Im September 1939 beginnen die Notizen, sie handeln vom Warten auf die Deutschen und den Kriegseinsatz, es geht um öde Arbeiten und schließlich um den 10. Mai 1940: „Roger, es geht los. Die Deutschen haben Belgien angegriffen.“ Mit diesen Worten wird der junge Soldat aus dem Bett gescheucht. Es ist der Beginn einer Odyssee. Die Kapitulation Frankreichs erlebt Roger in deutscher Kriegsgefangenschaft, am 15. Mai ergibt er sich, nachdem sein Freund Cotten bei einem Schusswechsel schwer verletzt wurde. Im Juni 1940, als das Waffenstillstandabkommen zwischen Frankreich und Deutschland in Kraft tritt, leistet Roger bereits Zwangsarbeit im „Stalag IV B“, einem Kriegsgefangenenlager bei Leipzig. Geplagt von Unterernährung, Krankheiten und prügelnden deutschen Soldaten führt er sein Tagebuch fort und schildert detailliert den Alltag als Kriegsgefangener in Deutschland. Leider bricht sein Bericht – und damit auch Sillorays Comic – mit einem letzten Eintrag vom 1. Januar 1941 ab.

Lee Miller: „Krieg. Mit den Alliierten in Europa 1944-1945. Reportagen und Fotos“.
Aus dem Englischen von Andreas Hahn und Norbert Hofmann. Edition Tiamat, Berlin 2013. 336 Seiten. 24 Euro
Während Jacques Tardi in einen fiktiven Dialog mit seinem Vater tritt, begibt sich Florent Silloray auf die Suche nach den Spuren der historischen Orte in der Gegenwart. Der Zeichner möchte die Wirkmächtigkeit der Vergangenheit in der Gegenwart zeigen. Wirkmächtig ist das Geschehene in seiner Familie, wie nicht zuletzt das Schweigen des Großvaters über die erlebten Grausamkeiten, etwa den Transport im Viehwagen von Frankreich nach Deutschland, deutlich macht. Aber auch außerhalb der Familie begegnet er der Vergangenheit. Während seiner Spurensuche im Ostdeutschland der Gegenwart begegnet Florent Silloray einer misstrauischen Bevölkerung und Naziparolen auf Brückenpfeilern in Torgau. Während seiner Recherche trifft Silloray auch Wolfgang Oleschinski, den Leiter des Dokumentations- und Informationszentrum Torgau, der die Dokumente des Großvaters sichtet: „Mit einem Lächeln erklärt er mir, er habe während seiner Karriere nur ein einziges Mal eine Quellensammlung von solch einem historischen Wert präsentiert bekommen.“
Lee Millers Reportagen sind gekennzeichnet durch einen distanzierten Blick, der, wie Klaus Bittermann im Nachwort schreibt, umso mehr Tiefenschärfe besitzt: „Vielleicht vermittelten ihre für den Tag geschriebenen Artikel aus diesem Grund eine ziemlich genaue und lebendige Vorstellung vom Krieg und seinem Elend.“ Auch die Suche der beiden Comiczeichner nach den Erinnerungen ihrer Vorfahren, nach Spuren in der Gegenwart und nach Antworten auf das jahrzehntelange Schweigen vermitteln im Spannungsverhältnis von biographischer Nähe und Distanz, dem behutsamen Umgang mit dem Quellenmaterial und Recherchen in der Gegenwart eine lebendige Vorstellung vom Elend des Überlebens in deutscher Kriegsgefangenschaft. Auch wenn beide Zeichner eine Tendenz zu versöhnlichen Gesten haben – angedeutet durch die Reise von Florent Silloray nach Deutschland beziehungsweise durch verwunderte Nachfragen Jacques Tardis, wenn sein Vater seinen Hass auf „die Boches“ artikuliert –, haftet den Comics nichts Versöhnliches an.
JONAS ENGELMANN (ursprünglich erschienen in: Jungle World)





