
© Ivo Schweikhart
Der am 14.2. erscheinende Reader „Für immer in Pop“ liefert erneut einen Querschnitt seiner Texte über Musik: Interviews mit Nirvana oder Henry Rollins, Artikel über die Veränderungen von Subkulturen und den „Mainstream der Minderheiten“, aber auch ein Nachruf auf den Komponisten Iannis Xenakis stehen neben selbstkritischen Beschäftigungen mit der Zunft der Plattenkritiker und -sammler.
„Die Bedeutung von Nirvana ist nicht größer als die einer Jeans!“ Martin war nie um eine provokante These verlegen, selbst wenn er mal danebenlag, aber gerade diese Tatsache macht seine Texte bis heute lesenswert.
Heute, am 12. Februar 2018, wäre Martin 50 Jahre alt geworden – aber mit Sicherheit nicht ruhiger. „Integrität ist Arbeit“, hat Klaus Walter in einem Nachruf geschrieben. Diese Arbeit, die immer den Verlockungen des Mainstream widerstanden hat, Kritik übte an reaktionären Tendenzen auch der eigenen Szene, veranschaulicht „Für immer in Pop“. Das Buch versammelt Texte, die Martin Büsser für das Fanzine „Zap“ verfasst hat, musikjournalistische Arbeiten der letzten zwanzig Jahre, Artikel aus der von ihm ins Leben gerufenen „testcard“ sowie Vorträge und Songtexte.
Mit seinem folgenden Artikel über die „Peanuts“, der zuerst 2010 im KONKRET-Magazin und im neu aufgelegten Sammelband „Music Is My Boyfriend“ erschienen ist, möchten wir anlässlich seines 50. Geburtstags an den so ungemein herzlichen wie unkorrumpierbaren Poptheoretiker und Journalisten Martin Büsser erinnern. „Seine Haltung, sein Denken, seine Texte würden heute dringend gebraucht“, schreibt Julian Weber in der heutigen taz. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Gibt es etwas Deprimierenderes als Kinder, die in ihrem Kindsein verharren? Die über Jahrzehnte einfach Kinder bleiben mit all ihren festen Gewohnheiten, unfähig zu jeglicher Entwicklung und völlig resistent gegenüber dem Verlauf der Welt mit all ihren Kriegen, Katastrophen, Skandalen und Sensationen? „Charlie Brown wird das kleine rothaarige Mädchen nie für sich gewinnen“, schreibt Denis Scheck im Vorwort zum Band der Peanuts-Werkausgabe, der die Jahre 1965 und 1966 umfasst, und bringt mit diesem knappen Satz die ganze Ödnis der Serie auf den Punkt. Alles bleibt in einer Zeitschleife gefangen. Nicht das Altern, sondern die Unmöglichkeit, älter zu werden, macht die „Peanuts“-Charaktere so bedauernswert. Genauer gesagt: die Unmöglichkeit, sich als Menschen im Laufe des Älterwerdens zu entwickeln, zu verändern.
Deprimierend an den „Peanuts“ ist nicht das Verharren im Kindesstadium, sondern die Erstarrung an sich. Charles M. Schulz hat nie Erwachsene gezeichnet. Möglicherweise wären die Eltern und Lehrer ähnlich ausgefallen wie Charlie Brown, Lucy und Linus, nämlich auf ebenso humoreske wie erschütternde Weise determiniert. Insofern stellt sich die Frage, ob die „Peanuts“-Charaktere am Ende vielleicht gar nichts anderes als verkleinerte Erwachsene sind, kindliche Vorboten der Tristesse, von der die meisten Menschen irgendwann in ihrem Leben zwischen Einfamilienhaus und täglichem Weckerklingeln erfaßt werden. Wer will, kann aus den Strips von Charles M. Schulz jede Menge Kapitalismuskritik lesen. Das geht, auch wenn der Autor bekennender Republikaner war.
Was könnte sie nur rausreißen aus ihrer Unbeweglichkeit? Wird der Tag kommen, an dem Lucy strahlend aufwacht und Charlie Brown freundlich begrüßt? Wird man Linus irgendwann ohne Schmusedecke sehen? Wird sich Schroeder einmal für etwas anderes als Beethoven interessieren? Wird Charlie Brown je einen Moment des Glücks empfinden? Nein, nein, nein. Alles bleibt. Und zwar im Sinne einer brutalen, auf Jahrzehnte angelegten Berechenbarkeit, die nichts mit der von Adorno beklagten kulturindustriellen Wiederholung des Immergleichen zu tun hat, sondern dem Theater von Beckett ähnelt. Das rothaarige Mädchen ist wie die Figur Godots. Beide treten nie in Erscheinung. Ob dieses rothaarige Mädchen nur in der Imagination von Charlie Brown existiert, bleibt völlig offen. Es ist auch egal. Die Unfähigkeit, sich der Angebeteten zu nähern, liegt an Charlie Brown selbst. An dieser Unfähigkeit würde sich auch nichts ändern, wenn es Tausende solcher Mädchen gäbe – oder eben gar keines. Zeitgleich mit dem 8. Band der Werkausgabe hat Andreas C. Knigge „Das große Peanuts-Buch“ herausgegeben, in dem er Charles M. Schulz zitiert: „In einem Zeitungsartikel wurde Charlie Brown einmal als ›Loser‹ bezeichnet. Das hat mich überrascht, denn so habe ich ihn nie gesehen. Ein Loser gibt irgendwann auf.“ Um so schlimmer! Diese Figuren machen einfach weiter, haben sich im Hamsterrad eingenistet. Nicht einmal aufgeben gelingt ihnen mehr.

Die 25-bändige „Peanuts“-Werkausgabe erscheint beim Carlsen Verlag
Mit Snoopy hat Charles M. Schulz ein versöhnliches Moment in seine Serie eingeführt, ein Wesen nämlich, das zeigt, dass Veränderung möglich ist. Gleich zu Beginn des Jahres 1965 gelingt dem Hund etwas, wozu Charlie Brown völlig unfähig ist: Snoopy trifft sich abends am See zum Schlittschuhlaufen mit einer Hündin, die nur in seiner Vorstellung existiert. Er spielt ganze Liebesszenarien mit ihr durch, während Charlie Brown aus der Ferne zusieht und feststellt: „Mein Hund ist durchgedreht.“ Diese Vorstellungsgabe, das Leben könne anders sein, als es ist, unterscheidet den Hund von den menschlichen Protagonisten und führt in den düstersten Cartoon der Comicgeschichte wenigstens so viel Prinzip Hoffnung ein, dass er erträglich bleibt. Kein Wunder also, dass Snoopy stets von allen Lesern geliebt worden ist. Auch von den GIs in Vietnam, die ihn auf ihre Hubschrauber malten, im Tiefflug auf der Hundehütte sitzend, das MG im Anschlag. Ein klassischer Fall von Zweckentfremdung.
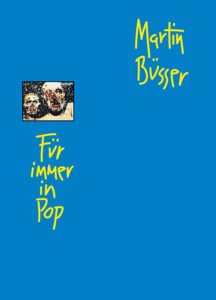
Martin Büsser: „Für immer Pop. Texte, Artikel und Rezensionen aus zwei Jahrzehnten.“
Ediert von Jonas Engelmann. Ventil Verlag, Mainz 2018. 240 Seiten, 15 Euro
Seit einigen Jahren erscheint im Carlsen Verlag die deutsche Peanuts-Werkausgabe, jeder Band umfasst zwei Jahre und gibt eine ganz neue Lesart vor. Statt den Fokus auf einzelne Cartoons, Figuren oder thematische Schwerpunkte zu legen, lässt sich die Serie nun wie ein langer Roman lesen. Der Wechsel der Jahreszeiten bestimmt das Geschehen, doch oft bringt nicht einmal mehr das Abwechslung. „Na bitte, was hab ich gesagt?“, meint Lucy im Januar 1963, während sie und Charlie Brown im Schnee stehen und in die Weite blicken. „Was?“, fragt Charlie Brown. – „Dieses Jahr ist auch nicht besser als das vergangene!“ Wahrscheinlich war es von Charles M. Schulz nie intendiert, dass Leute die „Peanuts“ chronologisch lesen und auf diese Weise all die Eintönigkeit empfinden, die das Leben der Vorstadtkids so lähmend und die Serie über weite Strecken so langweilig macht. All die Wiederholungen und oft nur winzigen Variationen von Ideen und Pointen waren natürlich dem Tagesgeschäft geschuldet: Damit die Erwartungen des Zeitungspublikums jeden Tag erfüllt wurden, musste Charlie Brown jeden Tag deprimiert sein. Seine Brutalität, Absurdität und narrative Radikalität erhält all das erst mit der steten Wiederkehr, also in Form dieses langen, am Ende 25 Bände umfassenden Romanfragments, abgebrochen durch den Tod seines Autors.
Schulz ist im Laufe der Jahrzehnte kaum auf gesellschaftliche Veränderungen eingegangen. Im Grunde gibt es nur zwei nennenswerte Ausnahmen: 1966 führte er Peppermint Patty ein, ein Mädchen in Sandalen und kurzen Hosen, das eine Baseballmannschaft leitet, mit der es künftig ständig gegen die Mannschaft von Charlie Brown gewinnen wird. Peppermint Patty ist ein Tomboy, also ein Mädchen, das auf Rollenverhalten pfeift und einfach nur selbstbewusst agiert, ganz gleich, ob einem Jungen oder einem Mädchen gegenüber. Sie wurde sehr schnell zur Ikone der amerikanischen Lesbenbewegung, was Schulz wiederum nicht verstanden haben soll.
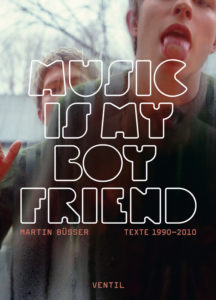
Martin Büsser: „Music Is My Boyfriend. Texte 1990-2010.“
Ediert von Jonas Engelmann. Ventil Verlag, Mainz 2018, 2. Auflage. 256 Seiten. 14,90 Euro
Die in den „Peanuts“ eingefangene Eintönigkeit des amerikanischen Vorstadtlebens steht am Beginn einer langen kritischen Auseinandersetzung der US-Kultur mit ihrem selbstgeschaffenen Idyll. Im Cartoon fand es seine Fortsetzung bei den „Simpsons“ und „South Park“, im Kino entstand sogar ein eigenes Genre. Dies hat zwar keinen Namen, doch jeder erkennt es sofort an den stets gleichen Kameraschwenks über gepflegte Rasenanlagen und Alleen, von „American Beauty“ bis „Ken Park“, von „Donnie Darko“ bis „Elephant“. Der Humor und die Sujets, die da verhandelt werden, sind drastischer geworden als zu den Blütezeiten der „Peanuts“, doch in der Grundaussage geht es bis heute nur um eine Frage: Wie kommt man hier raus? Im September 1966 erklärt Peppermint Patty genervt, dass sie für das Baseballteam von Charlie Brown keine Chancen mehr sieht. Sie war extra aus einem anderen Viertel gekommen, um zu helfen, doch ohne Erfolg. „Es ist hoffnungslos“, erklärt sie. „Ich verschwinde dahin, wo ich herkomme.“ Charlie Brown starrt lange ins Leere, seufzt: „Es muss schön sein, diese Möglichkeit zu haben …“





