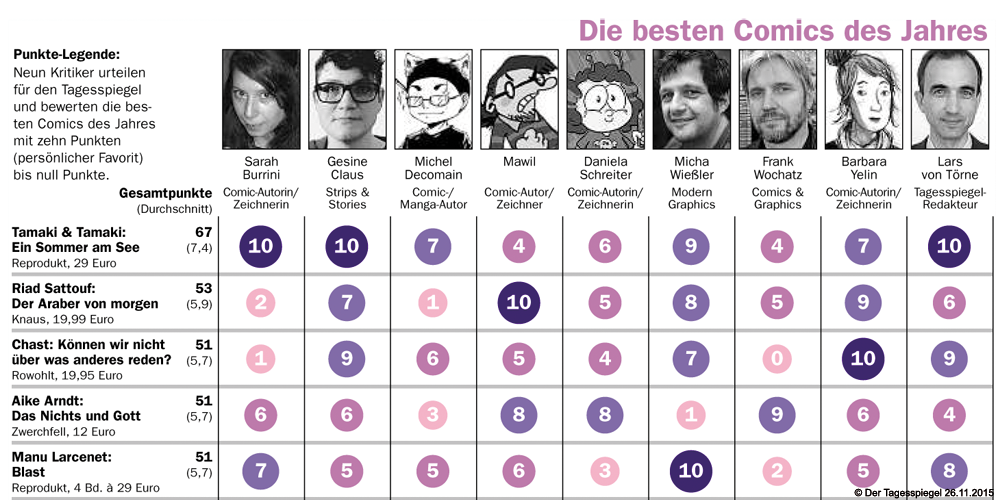Die deutsche Provinz ist ein fremdes Land, in das sich kaum ein Kamerateam, ein Reporter oder ein Maler begibt, ohne positive oder negative Klischees zu reproduzieren: eine Idylle, eine Hölle, immer beides zugleich. Und manchmal nicht einmal das, sondern nur zähe Beharrung bei gleichzeitiger eiliger Zerstörung. Wenn man vom Kapitalismus, von Drogen, von Gewalt und Verwahrlosung in Deutschland erzählen will, dann nicht aus den Metropolen. Dann aus der deutschen Provinz, country noir. Was die Filme, Texte und Bilder sonst nicht mehr vermögen, das können vielleicht Comics, die, was die Darstellung von Tristesse und Unheil anbelangt, unbefangenste und geduldigste Kunstform.
Das Land Sachsen-Anhalt hat für sich einen schön zwiespältigen, beinahe schon Grauen erregenden Slogan gewählt: „Wir stehen früher auf“, behauptet die Imagekampagne des Landes, und so wurde dies das „Im Land der Frühaufsteher“. In dieses freudlose Land führt die graphische Erzählung von Paula Bulling, eine Comic-Geschichte in Ich-Form, bewusst skizzenhaft, bewusst subjektiv, bewusst selbstreflexiv. Die Bild-Geschichte „Im Land der Frühaufsteher“ geht auf viele Begegnungen und Gespräche mit Asylbewerbern zurück, die die Autorin in Halle, Halberstadt oder Möhlau hatte. Sachsen-Anhalt mag eine besonders restriktive Flüchtlingspolitik betreiben, doch so oder so ähnlich sind die Verhältnisse in ganz Deutschland.

Paula Bulling (Text und Zeichnungen): „Im Land der Frühaufsteher“.
Avant-Verlag, Berlin 2012. 125 Seiten. 17,95 Euro
Paula Bulling ist klar, dass sie die Perspektive dieser Menschen, deren „Vergehen“ darin besteht, überhaupt da zu sein, nicht wirklich einnehmen kann. Während die Asylbewerber in ihren Unterkünften, die sich vom Knast nur durch ihre Verwahrlosung unterscheiden, bleiben müssen, kann sie nach ihrer Recherche wieder zurückkehren in die Freiheit und die Bequemlichkeit.
Aus ihrer Recherche entsprang ein ausgesprochen skrupulöses Vorgehen. Sie ließ zum Beispiel die Texte ihrer Sprechblasen von Ko-Autoren wie dem aus Burkina-Faso stammenden Noel Kaboré bearbeiten, der den Blickwinkel von Flüchtlingen persönlich kennt und diese vor Ort auch berät. Sehr genau beschreibt sie ein Leben mit Essensgutscheinen, Arbeitsverbot und Bewegungseinschränkung, in dem der Besitz eines Fernsehapparates ein Privileg bedeutet, das mit dem Verlust der Privatsphäre bezahlt wird.
Es ist die Geschichte einer Annäherung und des Versuchs einer Solidarisierung. Die Reise beginnt damit, dass Paula und ihre Freundin eine dreiviertel Stunde durch den Wald radeln müssen, um zum Heim zu gelangen. Wenn Aziz, Fatma und die anderen Asylbewerber die Isolation ihrer Unterkunft verlassen wollen, dann müssen sie mehr als eine Stunde Fußweg auf sich nehmen. Um was zu finden, im Land der Frühaufsteher? Auf allen Wegen begleitet sie die Angst vor rassistischen Übergriffen und vor der deutschen Bürokratie, die mit der Abschiebung droht. Eine Ahnung davon bekommt die Autorin bei ihren Besuchen im „Asylantenheim“, es gibt Ausweiskontrollen, Diskriminierungen, Besucherzettel. Allein der Kontakt zu den ausgegrenzten Menschen in den Heimen macht sie verdächtig.
Es sind harte, kräftige und nicht korrigierte Striche, es ist ein grundlegend tristes Dunkelblau, in dem die Zeichnerin kaum einen Trost, keine falsche Harmonie, keine Überhöhung zulässt. Paula Bulling argumentiert in ihrer Bilderzählung nicht, sie sieht nur genauer hin, als wir das gewöhnlich tun. Sie muss zeichnerisch einen Kontakt zwischen zwei Lebenswelten herstellen, den es in der Wirklichkeit kaum gibt.
„Die Unterbringung von Flüchtlingen soll ihre Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland fördern“ – so zynisch und offen wie in der Bayerischen Asyldurchführungsverordnung wird die unmenschliche Behandlung zwar nur selten beschrieben, doch es ist, so scheint es, sowohl offizielle Politik als auch gesellschaftlicher Konsens, Menschen, die „lästig“ sind, absichtlich zu demütigen und ihnen alle Grundrechte zu nehmen, ganz einfach um sie loszuwerden.
Die sieben Kapitel der Erzählung in Bildern folgen keinem dramaturgischen Kniff; vielmehr geht es darum, den in der deutschen Provinz ausgegrenzten Menschen eine Stimme zu geben, nein, mehrere Stimmen. Dass sie mit dem Tod eines Flüchtlings endet, ist nicht Dramaturgie. Sondern deutsche Wirklichkeit. Die Reise endet mit dem ungeklärten Tod des Flüchtlings Azad Murat Hadji. An der Aufklärung scheint die deutsche Justiz so wenig interessiert wie die Öffentlichkeit. Doch die allerletzte Szene zeigt Farid, Paula und Hadjis Frau Kristina mit den zwei in Deutschland geborenen Töchtern. Die Abschiebung der Familie konnte in letzter Minute verhindert werden. Man kann etwas tun, es liegt an uns.

Sophia Martineck (Text und Zeichnungen): „Hühner, Porno, Schlägerei – Deutsche Dorfgeschichten.“
Avant-Verlag, Berlin 2012. 52 Seiten. 14,95 Euro
Die Autorin beschreibt ihren eigenen Weg in eine verborgene Welt, die sie mit der Hilfe der Flüchtlingsorganisation The Voice fand. Diese half beim Zugang zum Heim Katzhütte in Thüringen, wo Paula Bulling den aus Nigeria stammenden Filmemacher Maman Salissou Oumarou (der an Filmen wie „Oury Jalloh“ beteiligt war) kennenlernte, der selber im Asylverfahren steckte und sehr genau wusste, was dort geschah. Mit ihm arbeitet sie bereits an weiteren Projekten, darunter ein Album mit dem Titel „Youssouf“, die Geschichte eines jungen Nigerianers, der wie so viele andere dem Traum von der Flucht in einen Teil der Welt folgt, in der es, vielleicht, weniger Gewalt, weniger Hunger, weniger Hoffnungslosigkeit gibt.
Einen ganz anderen, aber dann auch nicht weniger radikalen Blick auf die deutsche Provinz wirft Sophia Martineck in ihrem Buch „Hühner, Porno, Schlägerei – Deutsche Dorfgeschichten", der ebenso autobiographisch grundiert ist. Die Geschichte führt in ein trostloses, sterbendes Dorf namens Niederböhna, das nicht zuletzt deshalb so furchtbar wirkt, weil es Erinnerungen an durchaus Schönes bewahrt. Martineck zeichnet im Stil „naiver“ Kinderbücher (einschließlich großformatiger Ausklapptafeln), und das macht das Grauen, das hier lauert, nur noch drastischer.
Dieses Niederböhna, das es nicht gibt, weil es so viele davon gibt, ist ein typisches deutsches Dorf unserer Tage. Es liegt in einer sanften Landschaft mit Hügeln und Seen, die Landwirtschaft ernährt nur noch wenige, das Dorf ist stattdessen Schlafstadt für Menschen, die in der Stadt arbeiten, wenn es Arbeit gibt. Die lakonisch-höllischen Geschichten, die Sophia Martineck aus Niederböhna erzählt, von absurden Geschäften, Ausbrüchen von Gewalt, Bigotterie und Obszönität sind alle der deutschen Wirklichkeit, den Lokalzeitungen und den provinziellen Legenden entnommen. Symptome einer sozialen und ethischen Entwurzelung, pathetisch gesagt: das Kaputtmachen von Heimat. Das scheinbar naive Bild bricht sich oft an dem drastisch-nüchternen Text; was daraus entsteht ist indes mehr als eine satirische Text/Bild-Schere: Es bezeichnet wahrhaft die Falle, aus der man hier nicht mehr heraus kommt. Eine doppelte Begrenzung, gefangen im Alten und im Neuen, in der Provinz des Landes und in der des Internet, zum Beispiel. Die Sprache trifft sehr genau den Jive der entsetzten Nachbarlichkeit: „So etwas kennen wir nur aus der Zeitung: Die Herzogs waren immer sehr nette Leute gewesen. Sie haben zwei Jungs gehabt, auch die Großmutter lebte mit im Haus. Der Garten und das Haus waren immer sehr gepflegt gewesen. Auch im Haus deutete alles auf ordentliche Verhältnisse hin. Und dann sowas, hier bei uns.“ Durch das, was da gerade verloren geht, bleibt das Verlorene im kindlichen Strich und den wunderbaren „Buntstift“-Farben sichtbar, und durch die idyllisch-naivste Zeichnung schillert das Grauen. Country noir.
Man muss vielleicht die beiden graphischen Erzählungen, eher Sozialreportagen mit dem Zeichenstift als das, was man modisch gern „Graphic Novel“ nennt (wohl um das vulgäre Wort „Comic“ zu vermeiden), aneinander legen, um ein Bild der deutschen Provinz im Jahr 2012 zu bekommen. Wie können Menschen anderen Menschen Heimat anbieten, wenn sie doch ihre eigene selber gerade zerstören? Weil sie Kriege gegeneinander führen wegen eines Taubenschlags, weil sie jede kleinste Abweichung verachten, weil sie nicht mehr wer sein können, ohne es auf Kosten der anderen zu sein.
Beiden Arbeiten gemeinsam ist, dass die Autorinnen ganz und gar ohne Überheblichkeit, Besserwisserei und Appellation auskommen. Graphische Reportage, Soziologie mit dem Zeichenstift, wie immer man dieses immer noch neue Genre nennen mag, es ist eine künstlerische Geste gegen die Blindheit im eigenen Alltag. Die Wiedergeburt des politischen Comic aus dem Geist der teilnehmenden Beobachtung.
Dieser Text erschien zuerst in: Jungle World
Georg Seeßlen, geboren 1948, Publizist. Texte über Film, Kultur und Politik für Die Zeit, Der Freitag, Der Spiegel, taz, konkret, Jungle World, epd Film u.v.a. Zahlreiche Bücher zum Film und zur populären Kultur, u. a.: Martin Scorsese; Quentin Tarantino gegen die Nazis. Alles über INGLOURIOUS BASTERDS; Blödmaschinen. Die Fabrikation der Stupidität (zusammen mit Markus Metz); Tintin, und wie er die Welt sah. Fast alles über Tim, Struppi, Mühlenhof & den Rest des Universums; Sex-Fantasien in der Hightech-Welt (3 Bände) und Das zweite Leben des ›Dritten Reichs‹. (Post)nazismus und populäre Kultur (3 Bände). Kürzlich erschien in der Edition Tiamat Is this the end? Pop zwischen Befreiung und Unterdrückung.