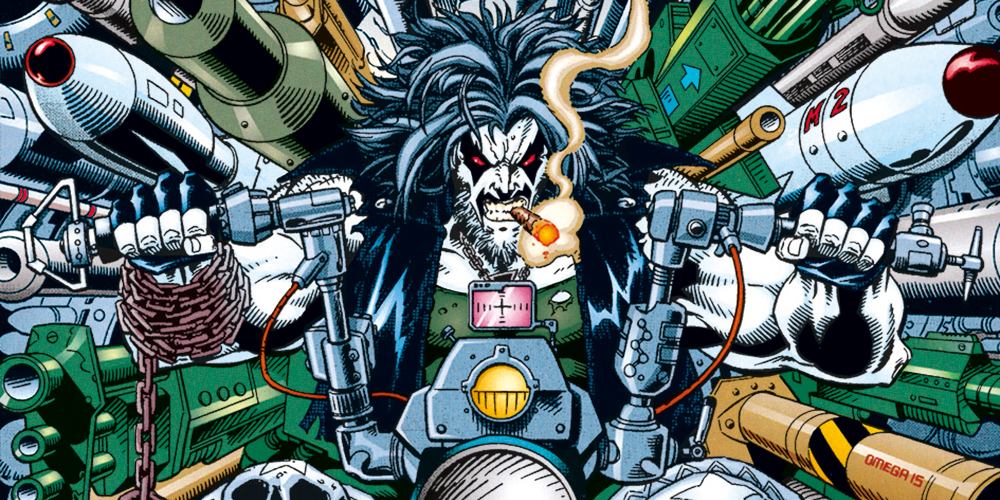„Sein Kopf bevölkerte sich mit dem, was er in den Büchern fand, mit Verzauberungen und Turnieren, mit Schlachten, Fehden, Blessuren, Liebesschwüren, Amouren, Herzensqualen und anderem abwegigem Unfug. All das nistete sich so fest in seinen Geist ein, dass ihm das Lügengebäude der Phantastereien, von denen er las, ganz unverrückbar wurde und es für ihn auf Erden keine wahrere Geschichte gab.“
– Miguel de Cervantes: „Don Quijote von der Mancha“ (i.d. Übersetzung von Susanne Lange)
„You got to roll with the punches and get to what’s real“
– Van Halen: „Jump“
Die 80er lassen uns bis auf weiteres nicht mehr los – ein Gegenwartsbefund, der bis in das Jahr 2045 reichen wird, wenn es nach Ernest Clines 2011 veröffentlichtem Science-Fiction-Roman „Ready Player One“ geht, den Steven Spielberg nun in einer losen Verfilmung auf die Leinwand bringt: In besagtem Jahr 2045 nämlich ist die Wirklichkeit ein grenz-apokalyptischer Ort, vor dem schlicht kapituliert wurde. Stattdessen fliehen deren Insassen jede freie Minute in die OASIS, eine virtuelle Realität, die sich maßgeblich aus den Vorgaben der Popkultur der 80er-Jahre speist – aufgepeppt mit einer Frische-Dosis aus Anime- und Onlinegames-Ästhetik versteht sich, die im Jahr 2045 ihren futuristischen Charme allerdings auch schon eine ganze Weile los sein dürfte. Während sich in der Wüste des Realen die Wohnwagen der Trailer Parks – Inbegriff des abgehängten White-Trash-Milieus – buchstäblich stapelweise auftürmen, wandeln sich deren Bewohner in der OASIS zu geschmeidigen 80s-Avataren, zur völligen Verkörperung der Texturen des globalisierten Kapitalismus des ausgehenden 20. Jahrhunderts: Im CyberSpace kannst Du sein, was und wer Du willst – sofern es innerhalb der Marktvorgaben geschieht (und die Filmproduktion die Lizenzrechte gezahlt hat).

© Warner Bros. Entertainment
So kommt es, dass in Spielbergs „Ready Player One“ die Referenzen im Sauseschritt an einem vorbeischrammen: Hier Freddy Krueger, dort Michael Jacksons „Thriller“-Outfit, kurze Debatte über John-Hughes-Filme, im Hintergrund blitzt der Space-Van aus Mel Brooks‘ „Spaceballs“ auf, eine bunte Tape-Sammlung als Wandschmuck und dann ein rasantes Autorennen im „Zurück in die Zukunft“-DeLorean – so sieht das aus, wenn meine Generation (ich bin Jahrgang 1978) bis ins Rentenalter nicht erwachsen wird und nachfolgende Generationen den bereitgestellten ästhetischen Fundus einfach immer wieder aufs Neue plündern. Ach du liebe Zeit.
Diese OASIS ist das Werk eines liebenswert schrulligen Nerds (Mark Rylance, ohne den kaum noch ein Spielberg-Film auskommt), der eigentlich nur spielen wollte und in tapsiger Manier eine Wunderwelt geschaffen hat, in der sich der Mensch letztendlich zu verlieren droht. Eine Mischung, wenn man so will, aus Mark Zuckerberg, Steve Jobs und Steven Spielberg selbst, die eines Tages vielleicht wirklich als Triumvirat der kulturellen Gegenwartsarchitektur gelten werden. Dieser OASIS-Nerd allerdings hat natürlich ein Herz aus Gold, zumindest aber goldene Ideale: Aus Angst vor dem Zugriff multinationaler Konzerne hat er in seiner ausufernden VR-Welt drei Schlüssel versteckt, die zu finden oberste Priorität für alle OASIS-Nutzer hat. Denn wer sie findet, gewinnt am Ende die ganze (virtuelle) Welt.
Kein Wunder, dass sich der jugendliche Wade (Tye Sheridan, ein typisches Spielberg-Kid-Face, das in den 80ern auch gut in „E.T.“, „Zurück in die Zukunft“, „Gremlins“ oder den „Goonies“ hätte mitspielen können) unter dem Decknamen Parzival auf die Suche nach dem heiligen Virtual-Reality-Gral macht – gilt es doch, die OASIS als Geschenk an die Menschheit vor den Übergriffen bösester Konzerne zu bewahren. Dazu gesellt sich eine Spielberg-Truppe zusammengewürfelter Kids: Aech (Lena Waithe) und Art3mis (Olivia Cooke) etwa, die zum großen Showdown die weltweiten Virtual-Reality-Massen beim Sturm auf die Bastille hinter sich vereinen können.

© Warner Bros. Entertainment
Schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Sagt zumindest Steven Spielberg auf seiner Promo-Tour, auf der er ständig betont, dass er sich seit „Jurassic Park“ nicht mehr so hemmungslos dem Popcorn-Diktat unterworfen habe. Tatsächlich ist im Blockbuster-Strang von Spielbergs Schaffen, das sich seit den 80ern lose in Arthaus- und Sause-Kino unterteilen lässt, seit geraumer Zeit der Wurm drin: Der einst so legendäre Spielberg-Touch, der einen in ungläubigem Staunen auf die Leinwand blicken ließ, scheint den Meister schon vor geraumer Zeit verlassen zu haben. In diesem Sinne ist Clines Roman eine Steilvorlage für Spielberg – zumal der Regisseur selbst darin Gegenstand kultischer Verehrung ist.
Auch vor diesem Hintergrund hat „Ready Player One“ etwas Verzweifeltes, Erzwungenes: An den gegenwärtigen 80s-Retro-Trend in vielen kulturellen Segmenten biedert sich der Film mit einer Vehemenz an, die einen selbst als Fan der populären 80s-Retro-Serie „Stranger Things“ peinlich berührt zurücklässt. Dass Spielberg seinen eigenen Fundus manisch auf die Leinwand kloppt, als sei das Zeug schon morgen keinen Cent mehr wert, wirkt wie die Gefallsucht eines vom Himmel gefallenen Engels. Wenn der einstige Prophet des Blockbusterkinos schließlich die Fantasy-Ästhetik der uninteressanteren Blockbuster der letzten zwanzig Jahre plündert und den Anime hinsichtlich Affektpotenzialen auspresst, komplettiert sich das Bild der Verwirrung eines alten Mannes, der die Gegenwart nicht mehr recht versteht, aber doch Teil daran haben will. Um wie viel entspannter ist dagegen das konsequent proletarische 80s-Riffing der beiden „Guardians of the Galaxy“-Filme.
Wobei es zwei Sequenzen gibt, die herausstechen, in denen tatsächlich durchgeknallte Kinomagie im Raum steht: Ein waghalsiges Autorennen quer durch ein virtuelles New York als Bewährungsprobe, das mit fröhlicher Blockbuster-Unbekümmertheit so ziemlich alles zu Klump schlägt, an dessen Widerständigkeit man in der echten Welt scheitern würde – ein Parcours, der dann dadurch getoppt wird, dass er unter den Bedingungen veränderter Vorzeichen noch mal, noch grandioser aufgeführt wird. Und eine Sequenz, die in die Filmgeschichte eingehen wird, weil sie buchstäblich in den Originalaufnahmen zu Stanley Kubricks „Shining“ stattfindet, die vom Computer unter behutsamer Wahrung authentischer Anmutung so zurechtgebogen werden, dass der Traum vom begehbaren Film zum Greifen nah scheint: Hier schließt Spielberg, in dessen Kino Experiment und Kommerz sich immer schon die Hand gereicht haben, tatsächlich an alte Glanzleistungen an und findet im Recycling des Fundus überlieferter Bildarchive noch einmal eine neue Strategie durch totale Anverwandlung. Man darf mit Spannung erwarten, welche filmischen Metastasen diese experimentelle Sequenz in den kommenden Jahren entwickeln wird.

© Warner Bros. Entertainment
Was sich vom Rest des Films nicht behaupten lässt. Zumal Spielberg sich zu einer arg verschwiemelten Pädagogik mit sonderbar narzisstischen Untertönen hinreißen lässt. Natürlich handelt „Ready Player One“ kodiert auch von unserer Gegenwart, davon, dass wir alle angeblich nur noch in unseren Smartphones und in virtuellen Welten leben, dass die Gegenwart von Pop-Diskursen total durchdrungen sei – gerade so, wie Don Quijote nur noch Ritterromane im Kopf hatte. Als Gegenmodell schwebt Spielberg eine Rückkehr ins Spielberg-Kinderzimmer der 80er vor, also in eine Zeit, in der Mensch noch Maßstab der Welt war, und in eine Welt, in der man am Wochenende „Goonies“ im Kino sah, auf dem Bett Superhelden-Comics las und auf einer alten Atari2600-Konsole spröde Pixel hin- und herbewegte. „So war das alles nicht gemeint“, scheint Spielberg im Blick zurück auf die Vergangenheit der Gegenwart als warnendes Menetekel für die Zukunft sagen zu wollen. Was im Zusammenhang mit den sanft ekstatischen Protuberanzen des Virtual-Reality-styled-Actionfeuerwerks, die er bis dahin reichliche zwei Stunden lang ausgekostet hat, wenigstens verlogen, schlimmstenfalls schizophren ist: Spielberg will den Kuchen essen und ihn gleichzeitig behalten.
Immerhin: Auf dem Weg zurück in die Zukunft des Kinderzimmers gelingen Spielberg beiläufig ein paar schöne Allegorien. Wenn es um die finale Schlacht des ehrlichen Unterhaltungs-Content-Fan-Proletariats wider die schurkische Konzernübermacht geht, dann findet dieser Kampf um die (virtuelle) Welt einerseits in einer Art „Herr der Ringe“-Simulationsscharmützel statt, andererseits aber insofern in der Realität, als die Kids sich mit ihren Brillen immer noch im konkreten Raum bewegen. Wenn also diverse Kids mit Sichtblende auf der Straße stehen und sich wunder was gegen imaginäre Feinde abmühen, kommt man nicht umhin, dabei an die Auseinandersetzungen zu denken, die in unserer Gegenwart in den sozialen Medien abgehen, wo sich rechte Trolle und linke Social-Justice-Warriors mit Elan und Eifer um die Sache der größten Mundschaumproduktion und der Eigenrelevanz-Versicherung verdient machen. Wodurch man den Eindruck gewinnt, der Bürgerkrieg tobe längst in den Straßen, wohingegen die realen Verhältnisse draußen über derlei Sozialdetails noch nicht einmal mit den Schultern zucken. Die Absurdität dieser Schere zwischen den gesellschaftlichen Sphären findet in Spielbergs von einem internationalen Multikonzern produzierten Film über den Kampf gegen einen internationalen Multikonzern eine schöne bildliche Entsprechung.
Diese Kritik erschien zuerst am 04.04.20218 auf: perlentaucher.de
Ready Player One
USA 2018
Regie: Steven Spielberg – Drehbuch: Zak Penn, Ernest Cline – Produktion: Donald De Line, Dan Farah, Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg – Kamera: Janusz Kaminski – Schnitt: Michael Kahn, Sarah Broshar – Musik: Alan Silvestri – Darsteller: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, T.J. Miller, Simon Pegg, Mark Rylance u. a. – 140 Min. – Verleih: Warner Bros. Pictures – Kinostart: 05.04.2018
Thomas Groh, Jahrgang 1978, lebt seit 1997 in Berlin, ist Redakteur bei Deutschlandfunk Kultur und schreibt u. a. für die taz, den Tagesspiegel, den Perlentaucher und weitere Medien über Filme. Im Netz anzutreffen ist er in seinem Blog und auf Twitter.