Markus Hug diktiert Bücher – er spricht Sätze in das Mikro seines Smartphones, eine Spracherkennungsapp wandelt diese Sätze dann in Text um. Hug ist stolz darauf, keinen Plot zu haben, keine Geschichte, sondern nur Sätze, die aus seinem Kopf, seiner Seele oder sonst woher stammen, zumal er bei diesem Schöpfungsakt gern in eine Art Trance fällt. Früher hätte man sowas écriture automatique genannt oder zumindest mit dem stream of consciousness rumhantiert, aber mit moderner Technik ist das wohl was anderes. Oder so. Mit Hugs Ehe läuft es nicht so toll, Säugling Andreas ist ein „Schreibaby“, die Gattin gibt Widerworte, und deren beste Freundin Conny löst bei Hug erotische Fantasien aus. Zudem schleppt sie einen Typen namens Gerhard an. Der arbeitet für ein IT-Startup namens BRAINFON, das verspricht, Gedanken in Text umwandeln zu können, ohne dass sie je artikuliert wurden. Das passiert mittels Mikrosensoren, die sich an entsprechenden Stellen im Körper ankoppeln, an denen mechanisch Sätze gebildet werden, bevor sie ausgesprochen werden – daraus errechnet dann die KI den Text, der auf dem Monitor erscheint. Das ist natürlich schwachsinnig, aber ein ideales Paranoiafutter, auf das Freundin Conny voll abfährt – und Hug zu einer Reise in die Vergangenheit führt, in der sein Vater als verkannter Künstler ein bedeutender Industrieller wurde.
Avancierte Technologie, Gedankenkontrolle und Totalüberwachung, verschiedene Modalitäten von Kreativität, das hat schon was Dystopisches. Zumal „Gläserne Gedanken“ formal ungewöhnlich daherkommt: Die sechshundert Seiten im schmalen Smartphone-Format sind wie ein Kalender gebunden, das Lesen simuliert das Scrollen, kleine Verschiebungen oder abgeschnittene Bilder tragen zu diesem Feeling bei. Und das Geschrei von Baby Andreas versaut, wie die Werbung im echten virtuellen Leben, oft die Bilder. Gnehm entwickelt eine sadistische Meisterschaft, mit den Phonemen „Bääähääää“ etc. zu terrorisieren, bis man das Baby am liebsten… (na,na, pfui).
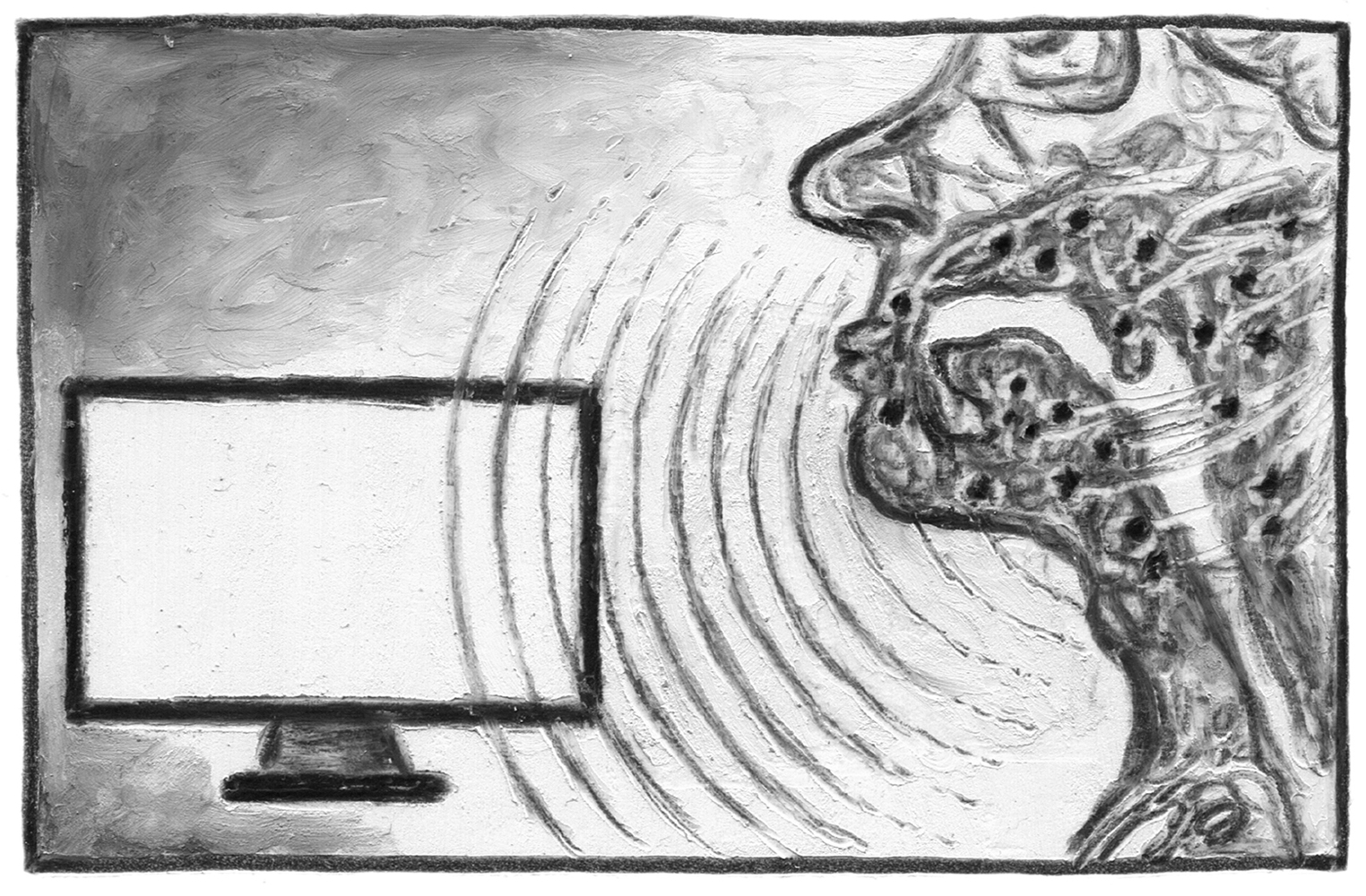
Bild aus „Gläserne Gedanken“ (Edition Moderne)
Formales und Inhaltliches sind durch diesen schlichten, aber genialen Dreh perfekt vereint. Wobei wir endlich bei der Bildebene angekommen wären. Gnehms schwarz/weiß/graue Bilder sind schon fast klassisch altmodisch. Sein Zürich ist verregnet und grau, seine Gebäude präzise abgemalt oder abstrahiert, je nach Gemütslage der Geschichte, seine Panels souverän, das Text-Bild-Verhältnis abwechselnd bild- oder textlastig, selten ausgeglichen, was für einen sehr angenehmen Leserhythmus sorgt. Alles sozusagen anti-zeitgeistig, konträr zur IT-Handlung gesetzt; auch Gerhard, der Nerd, sieht aus wie ein beliebiger Hipster-Spießer. Bildebenen-intern stiftet Gnehm Verwirrung – wenn traditionelle Malerei von Poussin bis Van Gogh aufgerufen wird, werden diese Gemälde eben nicht „paraphrasiert“, sondern bilden schwarze Verwischungen. Nur die Amateurbilder seines Vaters, Stilleben meist, werden liebevoll abgezeichnet. Auch für die angeblich so hochavancierte Technologie entwirft Gnehm keine Bilder – für jede Dialogszene im Regen ist der grafische Aufwand wesentlich höher. Man könnte sagen: Der IT-Komplex ist wenig beeindruckend, und so soll es auch sein.
Genauso wenig ist Hugs Kunst originell, er räsoniert zwar allerlei Krauses über das Schreiben, über seine Originalität, aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass seine „Poetik“ aus dem Surrealismus und den Anfängen der Moderne stammt, und man wundert sich kaum, dass er im Literaturbetrieb und auflagenmäßig nicht der ganz so große Zampano ist, wie er das gerne sehen würde. Und da mischt sich das Private ein: Das tyrannische Bääähäää, das oft die Bilder „verdirbt“, verdirbt auch den brennend-aktuellen Bezug der Handlung. Im positiven Sinn – da liegt Gnehms verschmitzte Komik. Hug wird letztlich dazu gezwungen, sich sein Leben noch einmal genauer anzuschauen und neu zu justieren.
Dafür gibt es dann – auch ironisch, würde ich vermuten – schöne Bilder der Zweisamkeit. Und so ist am Ende alles aufs Vergnüglichste demontiert: Die Bilder widersprechen der IT-Handlung, der Dystopie-Thriller-Plot löst sich in megalomanen Fidelwipp auf (und damit auch der obligatorische warnende Zeigefinger), die finale zuckrige Zweisamkeit minus Terror-Baby und der letzte Satz „Willst Du mich heiraten“ erinnern an die Drohung in Hitchcocks „To Catch a Thief“ („Über den Dächern von Nizza“; Sie wissen schon, das mit der Schwiegermutter) und führen in die durchweg deprimierend gezeichnete Wohnwelt des Paares in einem Mietshaus zurück. Das ist, wie immer bei Matthias Gnehm, wunderbar vertrackt, aber doch so einfach. Gut.
Dieser Beitrag erschien zuerst am 01.06.2022 auf: CulturMag
Thomas Wörtche, geboren 1954. Kritiker, Publizist, Literaturwissenschaftler. Beschäftigt sich für Print, Online und Radio mit Büchern, Bildern und Musik, schwerpunktmäßig mit internationaler crime fiction in allen medialen Formen, und mit Literatur aus Lateinamerika, Asien, Afrika und Australien/Ozeanien. Mitglied der Jury des „Weltempfängers“ und anderer Jurys. Er gibt zurzeit das Online-Feuilleton CULTURMAG/CrimeMag und ein eigenes Krimi-Programm bei Suhrkamp heraus. Lebt und arbeitet in Berlin.

Matthias Gnehm: „Gläserne Gedanken“. Edition Moderne, Zürich 2022. 640 Seiten (Kalenderbindung). 19 Euro.





