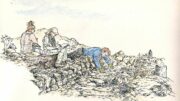Lange Zeit gab es mehr Darstellungen von Frauen als von Männern. Was dahintersteckt und wie sich Rollenbilder wandelten, zeichnet „Die Frau als Mensch“ nach.
Bärtige Männer mit Fellschurz und Keule, immer auf der Jagd nach Beute: Wenn wir an Steinzeitmenschen denken, sind Bilder wie diese immer noch fixer Bestandteil des kollektiven Bewusstseins – auch wenn sie wissenschaftlich überholt sind. Frauen waren in der Lesart der männlichen Forscher des 19. Jahrhunderts, die den Grundstein für die Rezeption der Urgeschichte prägten, allenfalls Symbole für Fruchtbarkeit und sexuelle Triebhaftigkeit – siehe die weltberühmte Figurine der Venus von Willendorf.
Frauendarstellungen wie diese sind für die renommierte österreichische Comic-Künstlerin Ulli Lust der Ausgangspunkt für eine Zeitreise durch die Frühgeschichte, in der sie so einige Bilder über die vermeintlich natürliche Dominanz des Mannes zurechtrückt. In ihrem soeben erschienenen ersten Teil des Sachbuch-Epos „Die Frau als Mensch“ taucht sie tief ein in die Kunst der Eiszeit und die Geschlechterrollen, die sie vermittelt.
Denn auch wenn man Statuetten von Frauen in vielen Museen mit der Lupe suchen muss, waren sie über einen Zeitraum von mehr als 30.000 Jahren weitaus häufiger als männliche Darstellungen – und repräsentierten somit offensichtlich die Kategorie Mensch. Von 702 Ganzkörperabbildungen in Höhlen oder in Form von Objekten, die in der europäischen paläolithischen Kunst (40.000 bis 11.000 Jahre alt) identifiziert werden konnten, waren gerade 74 männlich, zitiert Ulli Lust eine Forschungsarbeit zum Thema. Die Vielfalt dieser Bilderwelt lässt sie förmlich wiederauferstehen: Durch das ganze Buch ziehen sich Zeichnungen der Funde, von der ältesten, etwa 40.000 Jahre alten Menschenskulptur aus der Hohle-Fels-Höhle auf der Schwäbischen Alb, die eine Frau darstellt, über vulvenförmige Einritzungen in französischen Höhlen bis hin zu Gräbern und anderen Artefakten aus den verschiedensten Regionen der Welt.

Bis ins Neolithikum dominierten diese meist nackten weiblichen Figuren, einmal üppig-rund, dann wieder schlank und abstrahiert, doch praktisch immer stolz und selbstbewusst. „Viele dieser Figuren sehen reichlich unsexy aus. Das könnte daran liegen, dass sie nicht als Sexsymbole gemeint waren“, konstatiert Ulli Lust trocken. Auch das Bild der umsorgenden Mutter bedient die ikonische Frau der Eiszeit nicht: Manchmal ist sie schwanger, ein Kind hält sie nie. Frauen in traditionellen nomadischen Jäger-und-Sammler-Kulturen bekamen in der Regel nur alle drei Jahre ein Kind. Es wurde von der ganzen Gruppe, meist 30 bis 50 Personen, aufgezogen.
Während einige Fachleute die Geste des „Brüstezeigens“, das sich durch viele Kulturen zieht, als Drohgebärde verstehen, stellt Ulli Lust fest: „Im Vergleich zu martialischen Gewaltdarstellungen späterer Epochen wirkt der Bilderschatz der Eiszeit und des frühen Neolithikums insgesamt wenig aggressiv.“ Vor etwa 7000 Jahren wandelte sich das: Nach dem Ende der Eiszeit, als die Menschen sesshaft wurden und die Geburtenzahlen sprunghaft anstiegen, wurden Gewaltdarstellungen häufiger. Das ging einher mit einer wachsenden Zahl an Männerbildern, die sukzessive die Frauenstatuetten ablösten.
Auffällig ist für Ulli Lust auch, dass neben den Brüsten das weibliche „Schamdreieck“ im Zentrum der Ikonografie der Frühgeschichte steht, und dabei ganz ohne Scham präsentiert wurde. Erst im alten Griechenland durften Frauen nur noch unbekleidet abgebildet werden, wenn sie Göttinnen waren. Doch selbst Statuen der nackten Aphrodite zeigen eine Liebesgöttin, die ihre Brüste und ihre Vulva schamhaft verdeckt. Ganz im Gegensatz zu den antiken Darstellungen von Adonis und Co: Sie machen keinerlei Anstalten, sich für ihre Geschlechtsteile zu schämen. Für Ulli Lust ein Sinnbild für neue gesellschaftliche Normen, die bis heute weiterwirken.
Die Comicerzählerin, die schon lange in Berlin lebt, arbeitete fünf Jahre an dem Buch, verschlang Grabungsberichte, besuchte Originalschauplätze und Museen. Bekannt ist Ulli Lust vor allem durch ihre autobiografische Graphic Novel „Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens“, es folgten die Literaturadaption „Flughunde“ und „Wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein“. Ihr Interesse an der Frühgeschichte ist nicht neu: Schon ihre allererste Comicserie Springpoems war inspiriert von jungsteinzeitlichen Fruchtbarkeitsritualen, seither verfolgt sie wissenschaftliche Publikationen zum Thema.
Die Sachebene durchbricht Ulli Lust regelmäßig mit Einsprengseln und Episoden aus der Gegenwart. Sie erinnert sich etwa an ihre Kindheit, wo es gängig war, ein Mädchen als „das Mensch“ zu bezeichnen und das weibliche Geschlechtsteil als „Wurzel des Bösen“ galt. Oder sie bringt einen Exkurs über das Sozialverhalten bei Menschenaffen mit ihren eigenen Erfahrungen mit Manspreading im Flugzeug in Verbindung. Dabei wechseln klassische Comicpassagen mit illustrativen Seiten inklusive Digrammen, Karten und Stammbäumen ab, dazwischen lenken seitenfüllende Zeichnungen den Blick auf das große Ganze. Das in erdigen, pastellenen Farben gehaltene Werk wird komplettiert durch einen umfangreichen Anhang mit Quellen und Anmerkungen.

Nebenbei zeichnet Ulli Lust auch den Paradigmenwechsel nach, der in den letzten Jahrzehnten dafür gesorgt hat, dass Frauen ins Blickfeld der Geschichtsforschung treten – nicht zuletzt aufgrund der Beiträge weiblicher Wissenschaftlerinnen. Paläolithische Skelette, die zuerst als männlich eingestuft wurden, entpuppten sich nach neuen DNA-Analysen als weiblich. Heute weiß man, dass Frauen ebenso an der Jagd beteiligt waren wie Männer und vermutlich jeder und jede alle Fähigkeiten zum Überleben besitzen mussten, ganz unabhängig vom Geschlecht.
Ulli Lust geht außerdem den Strategien auf den Grund, die das Überleben unserer Spezies ermöglicht haben. Dabei führt sie unter anderem in die Kalahari-Wüste in Botswana, wo die Khoisan noch bis vor kurzem als nomadische Jäger und Sammler lebten. Sie hatten ein streng egalitäres Gesellschaftssystem, in dem Frauen und Männer gleichrangig waren. Ihre Kultur konnte so lange bestehen, weil sie „hypersozial“ agierten, so die Annahme. Die strategische Kooperation in der Gruppe setzte Wissen und Empathie voraus anstatt Aggression und Konkurrenz, wie viele alte Lehrbücher suggerieren.
Die Autorin nimmt uns auf 250 Seiten mit in von Eis und Schnee überzogene Grasländer, zu Ausgrabungsstätten wie im tschechischen Dolní Věstonice, zu den Wurzeln des Schamanismus in Sibirien oder den ältesten Höhlenmalereien auf der indonesischen Insel Sulawesi. Am Ende kehrt das Buch schließlich wieder zum Thema Scham zurück und rekonstruiert, wie prähistorische Frauen mit der Menstruationsblutung umgingen.
„Die Frau als Mensch“ reiht sich ein in eine beachtliche Riege an Sachcomics zur menschlichen Evolution, wie etwa Yuval Hararis „Sapiens“-Reihe und Jens Harders mit „Alpha“, „Beta“, „Gamma“ betitelte Bildergeschichte der Menschheit. Es erinnert auch an die Werke der schwedischen Starzeichnerin Liv Strömquist, die mit ihrer Kulturgeschichte der Vulva, „Der Ursprung der Welt“, eine Welle der feministischen Wissenschaftskritik im Comicformat losgetreten hat. Wo Strömquist ihrer Empörung freien Lauf lässt, hinterfragt Ulli Lust unser Verständnis der Frühgeschichte zurückgelehnt. Mit einer Mischung aus detaillierten Fakten und Erzählelementen erlaubt sie, sich selbst ein Bild zu machen. Das spricht ohnehin für sich.
Diese Kritik erschien zuerst am 22.02.2025 in: Der Standard – Comicblog Pictotop.
Hier und hier gibt es weitere Kritiken zu „Die Frau als Mensch“.
Ulli Lust: Die Frau als Mensch: Am Anfang der Geschichte • Reprodukt, Berlin 2025 • Hardcover • 256 Seiten • 29,80 Euro
Karin Krichmayr arbeitet als Wissenschaftsredakteurin für Der Standard. Außerdem betreibt sie für die österreichische Tageszeitung den Comicblog Pictotop.