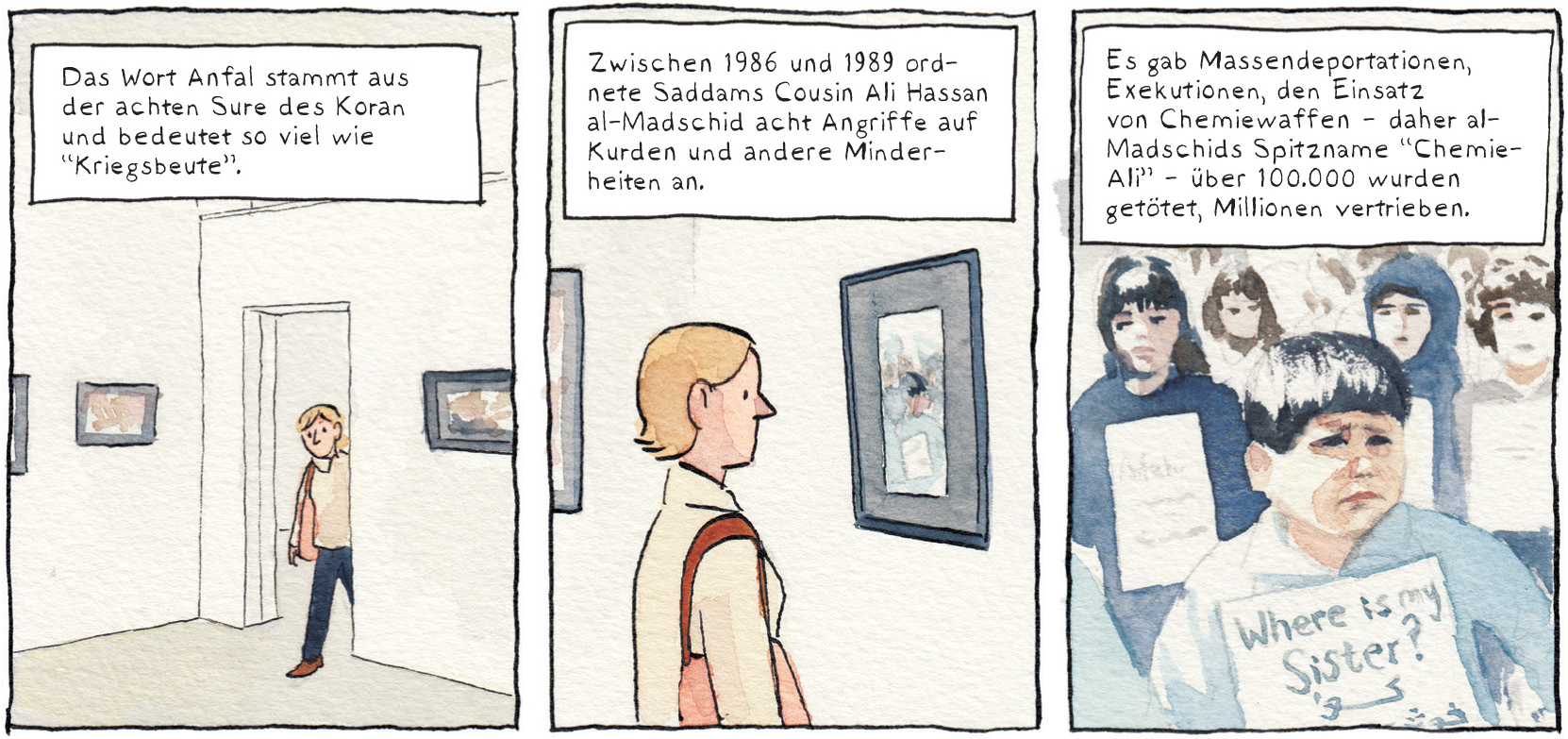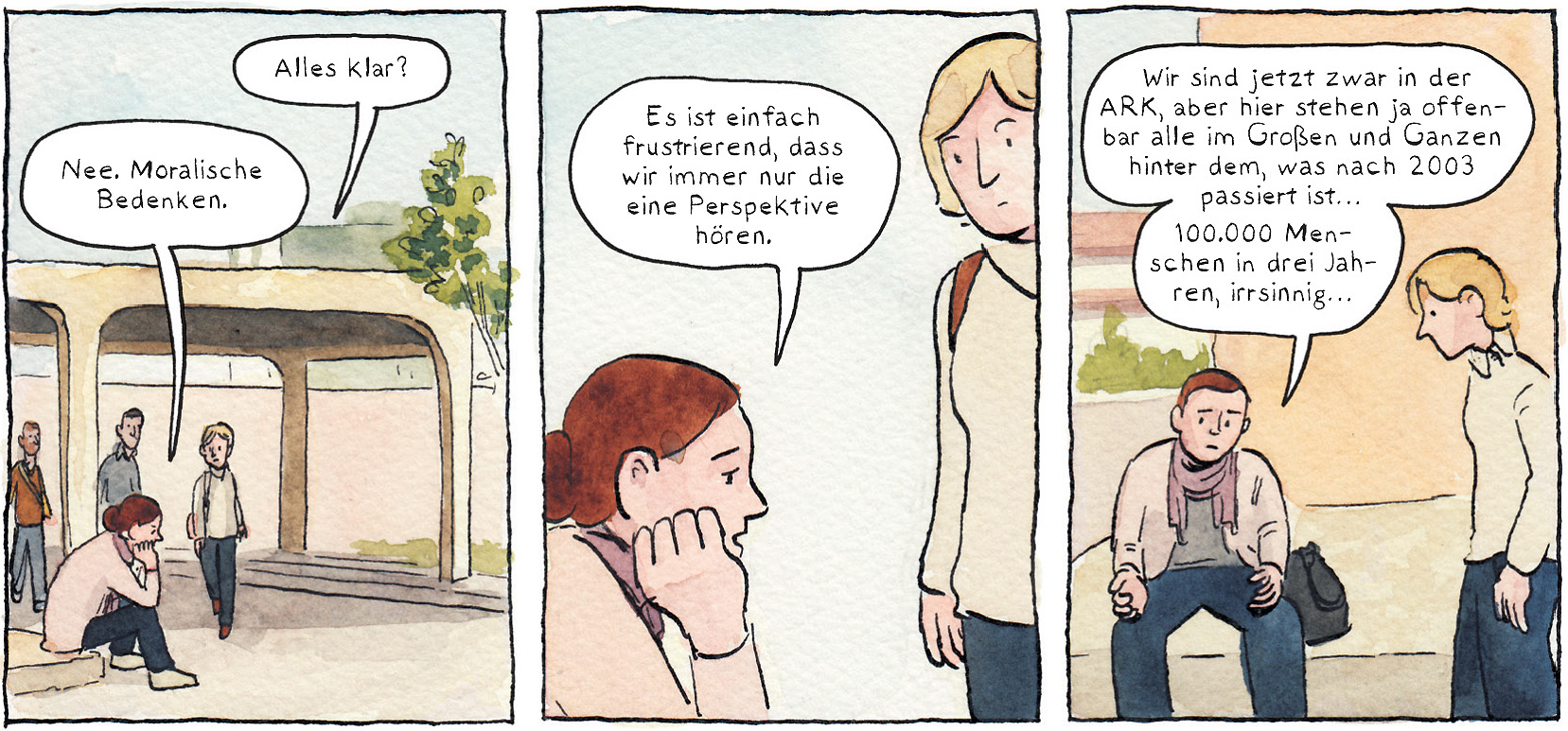Die US-Amerikanerin Sarah Glidden ist Comic-Journalistin. Im Interview erzählt sie über ihren Anspruch an sich selbst und den Journalismus im Allgemeinen, von ihren Erfahrungen in Irak und dem Umgang Amerikas mit den Folgen der Irak-Invasion und über den künftigen US-Präsidenten Donald Trump und wie man ihm entgegentreten kann.
 Liebe Sarah Glidden, „Im Schatten des Krieges – Reportagen aus Syrien, dem Irak und der Türkei“ ist Ihre zweite lange Graphic Novel. Wie kam das Projekt zu Stande?
Liebe Sarah Glidden, „Im Schatten des Krieges – Reportagen aus Syrien, dem Irak und der Türkei“ ist Ihre zweite lange Graphic Novel. Wie kam das Projekt zu Stande?
2006, ungefähr zur selben Zeit, als ich anfing Comics zu machen, haben ein paar von meinen Freunden hier in Seattle eine Non-Profit-Journalismus-Organisation gegründet. Sie hieß „Seattle Globalist“ und ihr Ziel war es, sowohl über wichtige regionale und kommunale als auch über geopolitische Themen zu berichten. Ihre Geschichten haben mich sehr beeindruckt und vor allem haben sie mir vor Augen geführt, wie wenig ich darüber wusste, wie Journalisten wirklich arbeiten. Über die Zeit ist in mir ein Plan gereift – ich wollte die Globalists bei einer von ihren Auslandsreportage-Reisen begleiten und dort vor Ort ihre Arbeit dokumentieren. Nicht zuletzt, um Antworten auf die Fragen zu finden, die mich beschäftigten: Wie finden Journalisten ihre Themen? Mit was für moralischen Fallstricken müssen sie sich auseinander setzen? Wie arbeiten „Fixer“, also die Rechercheure und Mittelsmänner vor Ort? Als wir gegen Ende 2010 nach Syrien aufbrachen, über die Türkei und den Irak, dachte ich, das würde ein einigermaßen simples, übersichtliches Unterfangen werden. Aber es stellte sich schnell heraus, das mir das Thema weit mehr abverlangte. Während unserer Reise wurde mir klar, dass mein Buch nicht nur über die Funktionsweise von Journalismus gehen würde, sondern auch über seinen Stellenwert in unserer Gesellschaft und darüber, welche Erwartungen wir daran stellen.
Wie genau hat die Arbeit an dem Buch Ihre Vorstellung vom Journalismus geprägt? Haben Sie Antworten auf Ihre Fragen gefunden?
Ich würde sagen, dass mir die Arbeit an „Im Schatten des Krieges“ zumindest ein tiefes Verständnis für die Arbeit von Journalisten vermittelt hat. Aber eine finale Antwort auf meine Fragen werde ich wohl nie erhalten. Letztlich ist das Berufsfeld vielleicht auch zu vielfältig. Ich denke, was alle Journalisten gemein haben, ist ihre Neugier und das Bedürfnis, die Welt zu verstehen, die Wahrheit aufzudecken und dieses Wissen mit anderen zu teilen. Was aber „die Wahrheit“ ist – das ist sicherlich sehr subjektiv. Ein guter Journalist ist jemand, der trotz seiner eigenen Perspektive sich selbst und sein Thema immer wieder mit den Fragen konfrontiert: Werde ich dem Thema gerecht? Habe ich alles bedacht? Gibt es vielleicht Aspekte an der Story, die ich übersehen haben könnte? Man darf nie davon ausgehen, dass man alles weiß. Es gibt immer mehr zu entdecken, wenn man tiefer gräbt.
Wie steht es um Ihre eigenen Arbeiten – würden Sie sagen, dass man Ihre Comics (allen voran „Im Schatten des Krieges“, aber auch ihre kürzeren Stories) als „journalistisch“ definieren kann. Wie unterscheidet sich Ihr Ansatz von dem von klassischen Magazin- und Zeitungsbeiträgen?
Die meisten meiner Arbeiten zur Zeit sind journalistischer Natur. Wobei ich immer wieder auch Geschichten zeichne, die zwar an Journalismus angrenzen, im Grunde aber schon ein anderes Genre sind: autobiografisches Erzählen. In der Regel sind aber auch die Geschichten aus meinem Leben, also Erinnerungsstücke, oft auch Erzählungen, anhand derer ich auf bestimmte gesellschaftliche Sachverhalte hinweisen will. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren einen kürzeren Comic gezeichnet über meine Zeit in Buenos Aires und die wöchentlichen Abendessen mit der Familie meines argentinischen Ehemanns. Im Kern ging es mir aber darum, darzustellen, wie unterschiedlich Familienstrukturen in Argentinien und den Vereinigten Staaten sind und woran das liegen kann.
Für meine eher journalistischen Comics arbeite ich mich entlang derselben Abläufe ab wie klassische Journalisten: Ich führe Gespräche und zeichne sie auf (ich frage immer um Erlaubnis, bevor ich das Aufnahmegerät einschalte – das ist die goldene Regel im amerikanischen Journalismus, egal wie sehr die NSA dieses Prinzip untergräbt). Ich versuche stets den Original-O-Ton zu verwenden und ich erfinde keine Dialogzeilen, die nicht gesagt wurden und auch keine fiktionalisierten Figuren, die für einen oder mehrere reelle Personen stehen sollen. Man könnte sagen, die wichtigste Regel ist: „Niemals die Leser täuschen.“
Meistens schieße ich so viele Fotos, wie ich nur kann, um später Referenzmaterial für meine Zeichnungen zu haben. Ich will die Menschen und die Orte, über die ich berichte, so authentisch wie möglich einfangen. Ein großer Vorteil vom Comic-Journalismus ist es, dass man nicht ein 1-zu-1-Abbild zeigt, sondern eher ein Gefühl für das Setting und den Charakter der Menschen vermittelt. Und dafür reicht es nicht, ein Foto zu schießen – man muss ein ganz genaues Auge für seinen Gegenstand und detaillierte Notizen und Referenzmaterial haben.
Comics können den Lesern helfen, die Menschen, über die man berichtet, besser und eingehender kennenzulernen. Und ich hoffe, dass durch meine Zeichnungen dem Leser eine Möglichkeit eröffnet wird, sich dem Thema anders zu nähern als durch eine Foto-Reportage. Comic-Reportagen sollten auf keinen Fall gängige Reportagen ersetzen. Vielmehr hoffe ich, dass Comicleser, die meine Bücher kaufen, so einen empathischen Zugang zu meinen Themen finden, und sich dann mit neuem Interesse in anderen Medien informieren und ihr Verständnis von dem Thema vertiefen können.
Die Recherchereise für Ihr Buch fand 2010 statt, wenige Monate vor dem Ausbruch der Unruhen in Syrien, die schließlich in dem Bürgerkrieg mündeten, der heute noch tobt und das Land zerrissen hat. „Im Schatten des Krieges“ ist nun sechs Jahre später erschienen. War es schwierig für Sie, an dem Buch zu arbeiten, während sich die Lage im Nahen Osten so schnell und so dramatisch wandelte?
Es war sehr belastend – vor allem weil viele Menschen, auf die wir während unserer Reise getroffen sind und zu denen wir freundschaftliche Bande geknüpft haben, durch die Ereignisse bedroht wurden. Zu vielen haben wir im Laufe der Zeit den Kontakt verloren. Man kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, Begegnungen mit Menschen zu zeichnen und nicht zu wissen, ob sie noch leben, ob es ihnen gut geht. Und das sind nur einige wenige Menschen, die ich persönlich kenne. Wenn man diese Menschen im Kopf multipliziert zu den Hunderttausenden, die entwurzelt wurden und auf der Flucht sind, dann kann man sich gegen ein Gefühl der Hilflosigkeit nicht erwehren.
Aber meine Sorge und emotionale Verstrickung ist natürlich nichtig im Vergleich zu dem, was die syrische Bevölkerung durchmachen muss. Ich sitze hier in meinem Atelier in einer sicheren westlichen Großstadt, während sie versuchen, ihre Familien zu schützen. Es gab Zeiten, zu denen ich dachte: „Was für einen Sinn macht es, an diesem Comic zu arbeiten, während da draußen so viele schreckliche Dinge geschehen.“ Aber letztlich: jeder Mensch hat andere Stärken, und vielleicht ist, diesen Comic zu machen, für mich die beste Art, einen Beitrag zu leisten. Die Lebensgeschichten der Menschen, die wir 2010 getroffen haben, sind wichtig und erzählenswert. Egal, welche Umwälzungen es in den Jahren danach in ihren Ländern gab. Und ich musste das beenden, was ich angefangen habe. Zudem denke ich, dass die anderen Themen meines Buchs – der Irakkrieg und seine Folgen, Journalismus im Allgemeinen – zeitlos wichtig sind, auch wenn sie natürlich zu verblassen scheinen, angesichts der Gräuel des Syrienkriegs. Die amerikanische Invasion hat den Boden bereitet für das, was jetzt in Syrien passiert. Und die mangelnde Auseinandersetzung mit journalistischer Praxis hatte in der Vergangenheit verheerende Folgen in den USA. Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist nur ein extremes Beispiel.
Ein faszinierender Subplot von „Im Schatten des Krieges“ ist die Geschichte von Dan, dem ehemaligen Soldaten und Freund der Globalists, der Sie auf der Reise 2010 begleitet hat. Zu Beginn sieht man ihn vor allem als Objekt der Berichterstattung, aber nach und nach merkt man, dass Ihnen seine Freundschaft zu Sarah Stuteville, dem Kopf der Globalists, genauso wichtig ist, wenn nicht sogar mehr.
Ursprünglich hat es mir überhaupt nicht gepasst, dass Dan auf die Reise mitgenommen wurde. Ich dachte, seine Geschichte würde meinem angedachten Ansatz in die Quere kommen. Aber fast sofort als wir in der Türkei ankamen, habe ich gemerkt, dass die Beziehung zwischen Sarah und Dan – sie sind ehemalige Schulfreunde, die sehr unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen haben – voller Spannung sein wird und dass es sich lohnen kann, diesen Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren. In all den Jahren seit der US-Invasion im Irak habe ich, zumindest kommt es mir so vor, noch nie zwei Leute mit unterschiedlichen Auffassungen dazu gesehen, die eine Diskussion über das Thema geführt haben. Dieser Dialog ist aber essentiell, weil viele Amerikaner diese Zeit lieber komplett aus ihrem Gedächtnis streichen würden. Die Beziehung von Sarah und Dan zueinander und ihre Streitgespräche schienen mir mehr und mehr stellvertretend zu sein für die Art, wie in unserem Land mit dem Krieg umgegangen wird. Je länger unsere Reise andauerte, desto sicherer war ich mir, dass ich das zu einem zentralen Element meines Buchs machen wollte.
Von all den irakischen und syrischen Menschen, deren Lebensgeschichten in „Im Schatten des Krieges“ vorgestellt werden, ist die des jungen Paares Momo und Odessa, die als irakische Flüchtlinge ausgerechnet nach Seattle geschickt werden sollten, am hoffnungsvollsten. Wissen Sie, was aus ihnen geworden ist? Haben sie es geschafft, nach Seattle überzusiedeln?
Ich bin mit den beiden noch in Kontakt, und sie haben tatsächlich so was wie ein Happy End erlebt. Nach Seattle haben sie es nicht geschafft – nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Syrien und den USA, wurde ihnen diese Chance verwehrt. Aber durch einen Bekannten wurde ihnen die Möglichkeit eröffnet, in Kanada Asyl zu beantragen, und sie leben jetzt seit mehreren Jahren in Vancouver. Ich habe sie dort besucht, und es war wunderbar, sie wiederzusehen. Wenn ich von „so was wie ein Happy End“ spreche, dann deswegen, weil ihr Leben als Flüchtlinge in Kanada – auch wenn sie in Sicherheit sind – niemals einfach sein wird. Sie sind weit weg von Zuhause, von ihren Freunden und Familien. Sich in einer neuen Sprache, einer neuen Kultur zurechtzufinden, ist niemals leicht.
Das ist etwas, was vielen Leuten nicht klar zu sein scheint: In den allermeisten Fällen würden Flüchtlinge es bevorzugen, wieder Zuhause zu sein – in einem Zuhause, in dem sie nicht um ihr Leib und Leben fürchten müssen.
Das Thema „Flüchtlinge“ hat in den letzten Jahren in Deutschland und Europa, aber auch in den USA maßgeblich den politischen Diskurs bestimmt. Vor allem der Umgang mit syrischen Flüchtlingen in den USA erscheint aus der Ferne geradezu absurd ungerecht. Die Menschen aus Syrien, die jahrelang Hunderttausende von Flüchtlingen aus dem Irak aufgenommen haben und damit die Folgen der US-Invasion indirekt abgefedert haben, befinden sich nun selber auf der Flucht und werden von den USA abgelehnt.
Es ist wirklich verstörend! Ich bin entsetzt, in welchem Maße und mit welchen Argumenten sich die Menschen in den Vereinigten Staaten dagegen stemmen, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Trump und andere Politiker haben den Wählern die Botschaft vermittelt: „Wir wissen nicht, wer diese Menschen sind. Sie wurden nicht hinreichend durchleuchtet.“ Aber das könnte fälschlicher nicht sein. Flüchtlinge, die es nach Amerika schaffen, haben mindestens zwei Jahre an Befragungen und Untersuchungen hinter sich. Wir wissen mehr über „diese Leute“ als über die eigenen Bürger, die mit weitaus größerer Wahrscheinlichkeit Unheil, wie Amokläufe, anrichten können. Ich hoffe wirklich, dass sich die Vernunft durchsetzt und dass wir anfangen, mehr für Flüchtlinge aus Syrien und anderen Ländern zu tun, aber ich bin nicht sehr zuversichtlich. Erst recht, nachdem Trump zum Präsidenten gewählt worden ist.
Wenn ich das aufgreifen darf – wir sprechen wenige Tage nach den US-Wahlen 2016, bei denen sich der Republikaner Donald Trump nach einer hassgeleiteten und provokanten Kampagne durchgesetzt hat. Bevor wir auf das Ergebnis der Wahl und ihrer möglichen Folgen eingehen, wollte ich über die Zeit davor sprechen. Sie selbst haben aus dem Wahlkampf berichtet – für die Comic-Onlineplatform THE NIB haben Sie Jill Stein, die Präsidentschaftskandidatin der Grünen, einige Tage begleitet und einen Comic über diese Zeit gezeichnet. Wie kam es zu dem Projekt?
Ich wusste nicht viel über Jill Stein, als ich einen Anruf von Matt Bros, dem Redakteur von THE NIB erhielt und gefragt wurde, ob ich nicht eine Reportage über sie machen wollen würde. Ich habe zugesagt, weil es mich reizte, eine Wahlkampfreportage zu machen – etwas, woran ich mich noch nie zuvor versucht habe. Es war sehr interessant! Jill Stein war eine faszinierende Person für eine Reportage, aber fast noch interessanter war, was ich alles über die Third Partys, die kleinen Parteien, erfahren konnte. Vor allem den politischen Gegenwind, der ihnen ins Gesicht bläst. Das alles habe ich in meine Comic-Reportage eingebaut. Die Third Partys haben in den USA einen schlechten Leumund, zu Unrecht, wie ich finde. Die Green Party muss man sich völlig anders vorstellen als Die Grünen in Deutschland oder in Österreich. Sie verfügen nicht über deren professionelle Strukturen und deswegen halten die Leute hier sie (machmal zu Recht) für eine Lachnummer. Aber die Leute hier verstehen nicht, wie schwierig es kleine Parteien in den USA haben – wie schwierig es für sie ist, zu Abstimmungen zugelassen zu werden. Sie sind zum Verlieren verurteilt. Jill mag nicht meine Wahl für eine Präsidentin gewesen sein, aber sie hatte genauso das Recht zu kandidieren wie jeder andere.
Relativ am Ende von „Im Schatten des Krieges“ zeigen Sie, wie sich die Globalists darüber unterhalten, dass laut einer Umfrage Journalist zu dem zweit meist gehassten Beruf in den USA gehört. Das war 2010 – gegenwärtig müssen wir erleben, wie Donald Trump (und andere populistische Politiker in West- und Osteuropa) in ihren Wahlkampagnen Zeitungen und andere Medien als korrupt und verlogen angreifen, und damit erfolgreich sind. Was kann Ihrer Meinung nach der Journalismus tun, um dieser Entwicklung entgegenzutreten?
Die Frage ist dabei, wer hier in der Verantwortung steht, zu reagieren – die Medien oder deren Konsumenten? Journalisten müssen sich mehr anstrengen, schlecht gemachter Berichterstattung und der Verbreitung von Falschinformationen, den Kampf anzusagen. Aber ich glaube auch wir, als Leser, Zuschauer und Zuhörer, müssen zu besseren, bewussteren Medienkonsumenten werden. Das Wort „Konsument“ kommt mir in dem Zusammenhang nicht leicht über die Lippen, aber seien wir mal ehrlich – Journalismus ist ein Geschäft, das sich rechnen muss, wenn es überleben möchte. Und wir haben die Möglichkeit, Arbeit zu unterstützen, deren Wert wir schätzen. Wenn News-Seiten glauben, dass ihre Leser eher auf Artikel klicken über Trumps neueste rassistische Auswüchse (und ihnen so die Werbe-Dollar erhalten bleiben) als auf einen Artikel darüber, was gerade im Jemen passiert, dann werden sie das auch so machen. Deswegen müssen wir sehr bewusst damit umgehen, was wir konsumieren und teilen. Es gibt verdammt guten Journalismus da draußen – und wir müssen dafür sorgen, dass er sich auch weiterhin lohnt.
Die Wahl von Donald Trump zum 45sten Präsidenten der Vereinigten Staaten hat nicht nur in den USA viele Menschen geschockt. Was ist Ihre Einschätzung für die kommenden Monate und Jahre? Was glauben Sie, warum der Milliardär in kürzester Zeit einen so großen Rückhalt in der Bevölkerung kriegen konnte?
Ich habe Angst, vor dem was kommt. Nicht für mich, aber für die weniger privilegierten Mitbürger wie Menschen anderer Hautfarbe, Flüchtlinge, Migranten oder Menschen aus der LGBTQ-Community. Die Zahl der Übergriffe gegen Minderheiten ist in den Tagen seit der Wahl nach oben geschnellt. Trumps Rhetorik scheint in den Tätern zu der Erkenntnis geführt haben, dass Rassismus jetzt gesellschaftlich akzeptiert ist. Und das ist erst der Anfang. Wer weiß, was in seinem Kopf vorgeht – was er oder jemand aus seinem Kabinett in Sachen Außenpolitik anstellt. Am meisten mache ich mir aber Sorgen über die Umwelt. Wir haben keine zusätzlichen vier Jahre, um entschieden gegen den Klimawandel vorzugehen. Wir müssen JETZT handeln. Trump hat – Stand eine Woche nach der Wahl – angekündigt, Fracking und Ölbohrungen voranzutreiben und Mittel für den Kampf gegen den Klimawandel zu kürzen. Das alles könnte tragische Folgen haben – und wir müssen jetzt umso mehr den Druck auf die Regierung aufrechterhalten und alles in unserer Macht Stehende tun, um den Schaden abzuwenden.
Was den Rückhalt in der Bevölkerung anbelangt, sollten wir nicht vergessen, dass Trump bei Weitem nicht von der Mehrheit der Amerikaner gewählt wurde. In den Vereinigten Staaten haben wir leider keine Wahlpflicht, und nur 53% der möglichen Wähler sind auch wirklich wählen gegangen. Ein bisschen weniger als die Hälfte dieser Wähler hat für Trump ihr Kreuz gemacht. Hillary Clinton hat die „popular vote“ gewonnen. Vielleicht führt das dazu, dass wir unser antiquiertes System der Wahlmänner endlich reformieren. Die Demokratische Partei sollte sich aber selbst fragen, wieso ihre Kandidatin es nicht geschafft hat, mehr Stimmen zu bekommen. Warum sind 47% der Wahlberechtigten Zuhause geblieben? Vielleicht hätte ein Kandidat wie Bernie Sanders, der ihre Interessen besser repräsentiert hätte, auch bessere Chancen gehabt. Wir werden es nie erfahren, aber die Demokraten sollten nicht den Fehler machen, diese Diskussion nicht zu führen.
Es fällt mir schwer, noch mehr zu dem Thema zu sagen, so wie es mir schwer fällt, mir ein Amerika unter Trump vorzustellen. Man kann nur hoffen, dass seine Wahl der Schock ist, der Leute aus ihrer Lethargie reißt und dafür sorgt, dass sie für ihre Rechte kämpfen. Vielleicht passiert das sogar schon …
Mehr über die Autorin auf ihrer Homepage Sarahglidden.com
Sarah Glidden: Im Schatten des Krieges – Reportagen aus Syrien, dem Irak und der Türkei. Reprodukt, Berlin 2016. 304 Seiten, € 29,00