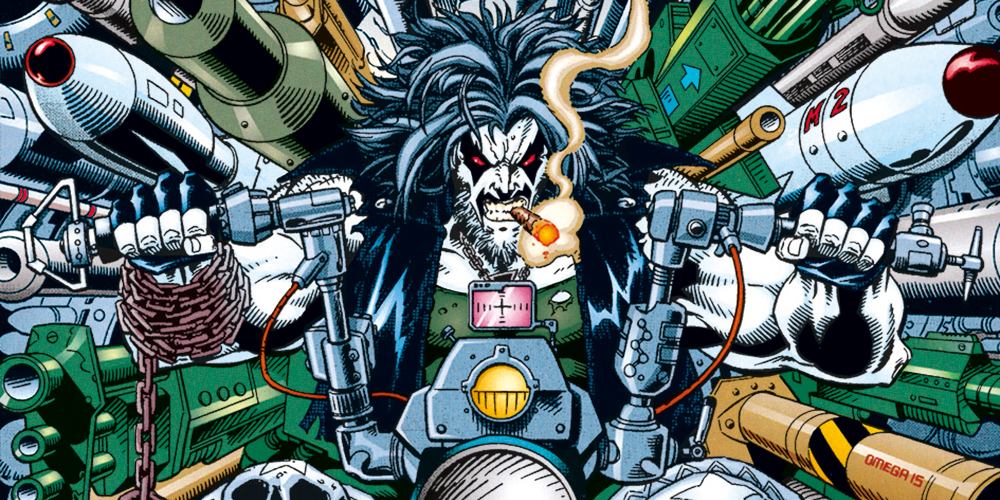Alan Moores und David Lloyds in den frühen 80er Jahren entstandener Comic „V for Vendetta“ ist eine voller Zorn und mit allem Pessimismus geschriebene Attacke gegen den Thatcherismus, eine Anklage der Unterdrückung des Menschen durch den Menschen und eine Liebeserklärung an die Kunst, in E- und U-Ausfertigung gleichermaßen. Auch wenn nicht jedes Detail recht stimmig, manches vielleicht auch platt geraten ist, zählt er sicher zu den herausragendsten Dystopie- und Anarcho-Comics und genießt deshalb, wie überhaupt Moores Gesamtwerk, vollkommen zu Recht seinen Ruf als „heilige Kuh“. Sein Faszinosum entspringt dabei nicht so sehr der strikten Gegenüberstellung eines in Guy-Fawkes-Maske auftretenden, mit viel Sprengstoff und einem fast enzyklopädischen Kunst- und Literaturwissen ausgestatteten Vigilanten und Einzelkämpfers mit einem faschistischen Regime, sondern vor allem aus dem minutiös sich entfaltenden Masterplan, mit dem „V“, so das Kürzel des Rächers mit beschädigter Seele, eben diesen technokratischen Machtapparat zu Fall bringt.
Keine gute Idee für eine Filmadaption des Stoffes ist es deshalb, nun gerade das hochkomplexe Verweissystem, das „V“s Agieren zugrunde liegt, weitgehend über Bord zu werfen; dann und wann ein keck aufgesagtes Shakespeare-Bonmot und ein Videoabend mit der jungen Evey, die er anfangs vor den Häschern des Regimes rettet und die – im Film weniger als im Comic – die Verbündete an seiner Seite im Kampf wird, müssen reichen. „V“s Schattengalerie, eine unterirdische Gruft wie aus dem „Phantom der Oper“, in der sich unzählige Schätze der Kunst und Literatur, der Malerei und des Films tummeln, wird zum bloß optisch reizvollen Gimmick; den Status jener faszinierenden Zeitkapsel, die sie im Comic darstellt, dieses mit wehmütiger Nostalgie gepflegten Archivs der Menschheitsgeschichte, das „V“ die entscheidenden Manöver im Kampf gegen die Welt der Aktenordner und Menschenmörder diktiert, erreicht die zwar liebevoll eingerichtete Lokalität in keinem Moment.

© Warner Bros. Pictures Germany
Wenig elegant sind auch die zahlreichen Einsprengsel, die den Film mit dem Hier und Jetzt verbinden sollen. Natürlich gibt’s ein wenig Islam-Kolorit, irgendwie steht alles mit dem „Krieg, den die USA begonnen hat“ in Verbindung (der Film spielt in de 2020er Jahren, der Comic war in den späten 1990ern situiert). Alles atmet Aktualitätsbezug, nichts ist durchdacht – reinste Exploitation. Ein bisschen billiges Revolutionspathos und den einen oder anderen augenzwinkernden Kommentar – „Manchmal reicht es, ein Gebäude zu zerstören, um die Geschichte zu ändern!“, sagt „V“ an einer Stelle – gibt es als Zuckerpulver obendrauf; gerade genug, um sich für das Emblem „Der Film ist als Diskussionsgrundlage geeignet“ zu qualifizieren.
Man geht nicht enttäuscht aus dem Film, dafür lässt er einen viel zu kalt; man winkt nur ab und es ist egal.
Dieser Text erschien zuerst am 13.06.2006 auf: filmtagebuch
V wie Vendetta
V for Vendetta. GB/D 2006.
R: James McTeigue.
B: Andy Wachowski, Larry Wachowski. K: Adrian Biddle. S: Martin Walsh. M: Dario Marianelli. P: Warner Bros, Silver Pictures, Studio Babelsberg u. a. D: Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, John Hurt u. a. 132 Min. Verleih: Warner. Start: 16.3.06
Thomas Groh, Jahrgang 1978, lebt seit 1997 in Berlin, ist Redakteur bei Deutschlandfunk Kultur und schreibt u. a. für die taz, den Tagesspiegel, den Perlentaucher und weitere Medien über Filme. Im Netz anzutreffen ist er in seinem Blog und auf Twitter.