Ach, Merry Old England – satte, grüne Wiesen, am tiefblauen Himmel die Sonne, die Vögel singen, und „als wäre das alles noch nicht genug, bog die Straße alle paar Meilen in ein kleines Dorf mit einer Kirche, einem Pub, einer Post und reetgedeckten Häusern ab … eines verfügte über ein Herrenhaus, ein anderes über einen Ententeich, ein drittes über einen Dorfanger oder eine große Eiche, unter der auf einer Bank zwei alte Männer saßen“.
Zu dem Idyll in Hampshire passt, dass auf Castle Farthing, dem Landsitz der Eversleys, ein Wochenendgast, Sir James Thirkie, ermordet worden ist und Inspektor Peter Anthony Carmichael mit seinem tüchtigen Sergeant Royston von Scotland Yard aus London herbeigeeilt kommt. Denn das Opfer war ein wichtiger Politiker, vielleicht sogar der Premierminister in spe. Wir sind im Mai des Jahres 1949. Die Insel scheint sich von den Folgen des Zweiten Weltkriegs gut erholt zu haben.
So trügerisch beginnt der Roman „Die Stunde der Rotkehlchen“ der walisischen Schriftstellerin Jo Walton. Je weiter man liest, desto mehr Risse tun sich auf. Ja, es ist bekannt, dass es auch im United Kingdom massive antisemitische Strömungen gab, aber dass es Juden verboten war, Land zu erwerben, war mir neu.
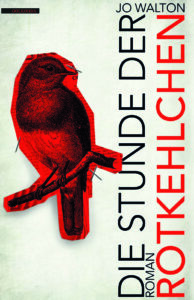
Jo Walton: „Die Stunde der Rotkehlchen“.
Aus dem Englischen von Nora Lachmann. Golkonda, Berlin 2015. 289 Seiten, 16,90 Euro
Jetzt also Jo Walton, die mit einer Trilogie zu ergründen versucht, wie sich auch auf der Insel der Faschismus breitgemacht haben könnte. Und damit natürlich auch, wie er sich breitmachen konnte – denn egal, ob historischer Roman, Was-wäre-wenn oder Science-Fiction: Im Grunde beschäftigen sich alle diese literarischen Formen mit der Gegenwart.
In Waltons Universum haben Großdeutschland und das Vereinigte Königreich nach Dünkirchen einen „ehrenhaften Frieden“ geschlossen, dessen Architekt der ermordete Lord Thirkie war. Der Führer erfreut sich großer Beliebtheit in England und kommt gerne zu Wagner-Premieren ins Palladium, während Kim Philby (der berühmte Sowjetspion) Staatssekretär ist.
In der Sowjetunion tobt immer noch der Krieg, in einer endlosen Schlacht um Kursk wechselt die Lage täglich. Die USA haben ihre Grenzen für Emigranten hermetisch verschlossen. Juden sind im Vereinigten Königreich gesellschaftlich geächtet, unterliegen wirtschaftlichen und politischen Restriktionen, sind aber noch nicht an Leib und Leben gefährdet. Das könnte sich ändern, wenn sich herausstellte, dass ein Jude der Mörder von Castle Farthing ist. Denn da ist praktischerweise einer zu Hand: David Kahn, der Mann, den das schwarze Schaf der stockkonservativen und ultrareichen Eversleys, Tochter Lucy, trotz der Missbilligung ihrer Eltern geheiratet hat.
Inspektor Carmichael, schwul und deswegen von seinen Vorgesetzten jederzeit steuerbar (das glauben sie zumindest), hat einen klaren politischen Auftrag: David Kahn als Mörder festzunehmen. Was interessierten Kreisen die Möglichkeit bieten wird, das gesellschaftliche Klima noch mehr an das als positiv empfundene des Deutschen Reiches anzugleichen. Denn Großbritannien ist eine hoch kapitalistische Klassengesellschaft, und die Aussicht eines Zugriffs auf jüdische Vermögen ist verlockend.
Waltons Roman ist intelligent ausgefuchst. Die am Anfang aufgebaute Landhausidylle mit Mord à la Agatha Christie wird durch die politischen Ungeheuerlichkeiten demontiert. Die Lösung des Mordfalls, ganz im Stil des Golden Age der Detektivliteratur geschildert, wird zur Farce. Und so entsteht ein bitterböses Bild der Sorte von Ideologiebildung, für die der klassische britische Landhauskrimi steht: Als ob es „unschuldige“ Mordspiele gäbe, die von a priori integren Detektiven gelöst werden könnten – während außen herum das Töten und Morden längst ubiquitär und flächendeckend geworden ist.
„Die Stunde der Rotkehlchen“ ist kein amüsant-gemütliches Spiel mit Geschichte, sondern ein sehr unbehagliches und unbequemes Projekt. Unter der vermeintlichen Harmlosigkeit der Form werden Befindlichkeiten und Dispositionen spürbar, die auch ganz aktuell sind: Waltons fiktives Großbritannien ist schon früh „thatcherisiert“, die Schere zwischen Arm und Reich ist weit offen, die Ressentiments gegen Minderheiten wie Juden schlagen gerade bei der unteren Mittelklasse durch.
Es gibt im Roman einen beiläufigen Dialog zwischen der herrschaftlichen Haushälterin und Lucy über deren Gatten David, den die sonst im Genre als „schrullig-snobistische Hausangestellte“ für ein paar Lacher zuständige Standardfigur pausenlos als „Judenbengel“ bezeichnet und sich an der Machtlosigkeit der Herrschaftstochter labt, mit der diese für ihre Liebesheirat bezahlt. Das ist noir im fiesesten Sinn. Beiläufig, aber enorm wirkungsvoll. So wie der ganze Roman eine einzige böse Sprengfalle für nette Konsense ist. Wir freuen uns auf die nächsten Bände.
Diese Kritik erschien zuerst am 09.03.2015 in: Jüdische Allgemeine
Thomas Wörtche, geboren 1954. Kritiker, Publizist, Literaturwissenschaftler. Beschäftigt sich für Print, Online und Radio mit Büchern, Bildern und Musik, schwerpunktmäßig mit internationaler crime fiction in allen medialen Formen, und mit Literatur aus Lateinamerika, Asien, Afrika und Australien/Ozeanien. Mitglied der Jury des „Weltempfängers“ und anderer Jurys. Er gibt zurzeit das Online-Feuilleton CULTURMAG/CrimeMag und ein eigenes Krimi-Programm bei Suhrkamp heraus. Lebt und arbeitet in Berlin.





