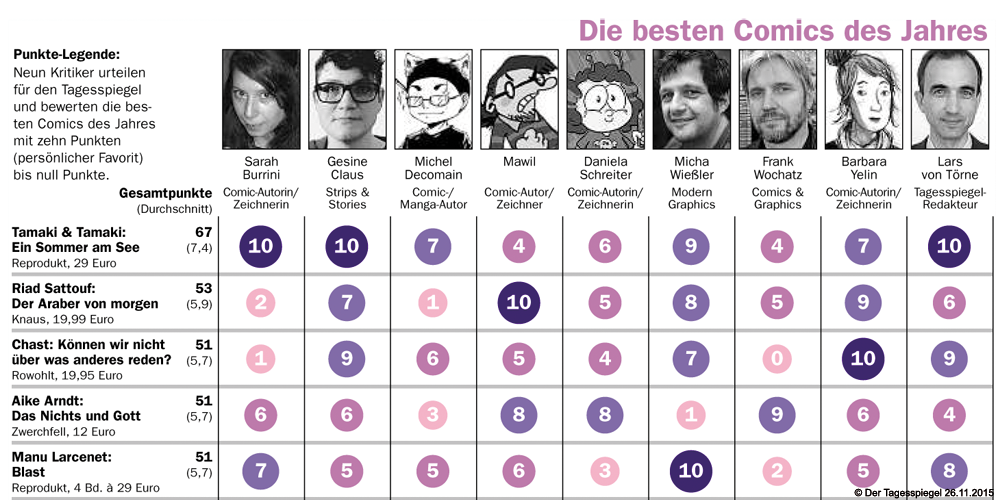„Bella Ciao“, Barus neuer Comic über italienische Arbeitsmigranten, schwankt zwischen dokumentarischer Echtheit und künstlerischem Eigensinn.
Immer mal wieder wird der Comiczeichner Baru (bürgerlich: Hervé Barulea) mit dem bekannten britischen Filmemacher Ken Loach verglichen. Tatsächlich haben die beiden einiges gemeinsam: Sie verorten sich explizit politisch links, was sich in ihrem jeweiligen Schaffen auch deutlich niederschlägt, sie sind Chronisten des sozialen Strukturwandels von der industriellen Hochmoderne zu einer postindustriellen Spätmoderne seit Mitte der 1970er Jahre, sie pflegen einen dokumentarisch angehauchten Erzählstil und gelten schließlich beide als ausgewiesene Meister ihres Metiers.
Ein gewichtiger Unterschied besteht allerdings in der Art und Weise, wie sich Baru und Loach ein Bild von ihren Figuren machen. Während letzterer in seinem konsequent naturalistischem Stil eine gewisse Distanz zu den Protagonist*innen seiner Filme aufrecht erhält, ist ersterer immer ganz nah dran an seinen Helden und – wenn auch wesentlich seltener – Heldinnen. Barus unnachahmliche Zeichenkunst besteht vor allem darin, die Momente innerer wie äußerer Erregung und Spannung so darzustellen, dass der Funke unvermeidlich auf die Leser*innen überspringen muss. Da erzählt Loach wesentlich nüchterner; was aber nicht heißen soll, dass das meist leidvolle Schicksal seiner Figuren nicht an Herz und Nieren gehen könne. Nur erscheint es irgendwie objektiver, allgemeingültiger.

Baru: „Bella Ciao Band 1“.
Aus dem Französischen von Uwe Löhmann. Edition 52, Wuppertal 2012. 136 Seiten. 20 Euro
Interessant ist dabei seine Definition von sozialer Klasse („meine Leute“), die er in einem Interview anlässlich des Erscheinens des ersten Bandes aufgestellt hat: die in den Banlieues der Großstädte lebenden Arbeiter und Migranten. Bei ihm stehen sie nicht als zwei Entitäten neben- oder gar gegeneinander, wie das andernorts immer mal durchscheint, sondern sie teilen eine soziale Realität. Das ist also Barus identitätspolitischer Anspruch, auf den ich gleich noch näher eingehen werde.
Im nun vorliegenden Band eins („Uno“) von „Bella Ciao“ werden die Leser*innen episodenhaft mit dem Los der italienischen Diaspora in Frankreich konfrontiert. Manche der meist titellosen Geschichten haben einen autobiografischen Charakter, andere wiederum wurden aufgrund ihrer historischen oder gegenwärtigen Ereignishaftigkeit vom Autor ausgewählt. Eröffnet wird der Comic durch die Erzählung über ein Massaker an italienischen Wanderarbeitern im kleinen Städtchen Aigues-Mortes durch die einheimische Bevölkerung im Jahre 1893, gefolgt von einer genealogischen Rekonstruktion der (vermeintlichen) Partisanenhymne Bella Ciao. Weiterhin wird davon erzählt, wie in den 1930er Jahren der Faschismus die italienische Exil-Community entzweite und antifaschistische Italofranzosen im Bataillon „Garibaldi“ der Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg kämpften und ihr Leben ließen. Nicht zuletzt geht es aber auch um in Knöchelhöhe abgeschnittene Hosenbeine, blanchierte Cappelletti und rettende Einbürgerungsurkunden. Und immer geht es um die Frage, ob und wie so etwas wie Heimat für die migrantische Arbeiterklasse überhaupt möglich ist.
Wer bereits einmal einen Comic von Baru in den Händen hielt, wird von seinem neuesten Werk allerdings überrascht, möglicherweise sogar etwas befremdet sein. Dabei beginnt alles, wie man es vom Autor gewohnt ist. Die Darstellung des fremdenfeindlichen Gewaltexzesses von Aigues-Mortes, in welchem zehn italienische Arbeiter in den Salinen vor den Toren der mittelalterlichen Festungsstadt von aufgebrachten Einheimischen gemeuchelt wurden, knüpft sowohl in ästhetischer als auch thematischer Hinsicht an andere Erzählungen des Comicautors an. Der Niedergang und die Prekarisierung des Proletariats ist bei Baru immer auch verknüpft mit der Brutalisierung seiner meist männlichen Protagonisten. Ein verzweifelter Versuch, die bereits verloren gegangene Kontrolle über das eigene Leben wiederzuerlangen. In diesem Fall sind es die einheimischen Arbeiter, die sich brutalstmöglich ihrer billigen Konkurrenz entledigen, anstatt die Wut über ihre Ausbootung auf die wohlhabenden Betreiber der Salinen zu projizieren. Neben die identitätspolitischen Aspekte Ethnizität und Klasse stellt der Comicautor also einmal mehr den (Gender-)Aspekt der toxischen Männlichkeit: Männer erscheinen zugleich als Opfer und Täter einer strukturellen wie körperlichen Gewalt und sind damit zumindest nicht automatisch Nutznießer der patriarchalischen Gesellschaftsordnung des späten 19. Jahrhunderts.Ins Auge fällt allerdings die zunehmende Textlastigkeit des Bandes, die nicht unbedingt von den Dialogen in den Sprechblasen herrührt. Zahlreiche längere Texteinschübe kommentieren das Erzählte, authentifizieren es und versuchen sich an einer historischen bzw. soziologischen Einordnung. Das ist ungewöhnlich für einen Autor, der den Trend zur Intellektualisierung und Literarisierung des Comic stets argwöhnisch betrachtete und auch mal spöttisch als „Chris-Ware-Syndrom“ bezeichnete. Barus verschriftlichte Authentizitätsbeteuerungen sind zwar bedingt durch seinen Wechsel ins Register des historisierenden Sachcomic. Allerdings sind Teile dieser Beglaubigungsstrategien wiederum selbst fiktional, etwa wenn er die getöteten Männer von Aigues-Mortes zum Gedenken mittels abgezeichneter Porträtfotografien auf einer ganzen Seite abbildet, um dann auf der nächsten Seite in einer Fußnote flapsig zu bemerken, dass es sich hier eigentlich um ganz andere Personen handelt, weil von den Getöteten eben keine Aufnahmen existieren. Hätte er sich angesichts solcher „Schummeleien“ nicht den ganzen Aufwand der Beglaubigung sparen können? Nicht zufällig ist der Comic meiner Meinung nach immer dann am stärksten, wenn sich die Geschichte durch das Handeln der Figuren und Barus expressionistisch anmutende Zeichnungen seiner Protagonisten bzw. Antagonisten selbst trägt und es keiner weiteren Erläuterungen bedarf.
Als Eindruck bleibt von „Bella Ciao“ diese eigentümlichen Ambivalenz zwischen ausgestelltem dokumentarischen Stil und dem Beharren auf künstlerischer Freiheit. Nichtsdestotrotz sollte man dem mittlerweile fast vierundsiebzigjährigen Baru dafür Respekt zollen, in fortgeschrittenem Alter noch derart neue Wege zu beschreiten. Man kann gespannt sein, in welche Richtung sich die beiden noch folgenden Bände entwickeln werden. Der Comicautor ist offensichtlich immer wieder für Überraschungen gut.
Diese Kritik erschien zuerst am 10.02.2021 auf: Taz-[ˈkɒmik_blɔg]
Hier gibt es ein Interview mit Baru zu „Bella Ciao“.
Mario Zehe (*1978) ist Politikwissenschaftler und arbeitet als Lehrer für Geschichte, Politik & Wirtschaft an einer Freinet-Schule bei Quedlinburg (Harz). Seit vielen Jahren liest er Comics aller Art, redet und schreibt gern darüber, u. a. im [ˈkɒmik_blɔg] der Taz und für den Freitag.

Seite aus „Bella Ciao“ (Edition 52)