Zum Internationalen Frauentag empfehlen wir zehn Werke für die feministische Comic-Bibliothek:
„Julie Doucets allerschönste Comicstrips“
Die Comics von Julie Doucet teils 25 Jahre nach ihrer deutschen Erstveröffentlichung in dieser Sammlung erneut zu lesen, ist eine sehr melancholische Angelegenheit. Nicht, weil früher alles besser war, sondern weil ihre Comics immer zwischen den beiden thematischen Polen Angst und Langeweile pendeln, die heute im neoliberalen Cyberspace einen dialektischen Bund eingegangen sind. Angst ist politisch, weil sie zur Kontrollinstanz der prekären Arbeitsverhältnisse gemacht wurde. Und Angst ist der ständige Begleiter der stets eingesetzten Figur Julie Doucet: Angst zu versagen, die Illustrationsjobs von neuen Auftraggebern nicht zu packen, die Abgabetermine beim Kunststudium zu versemmeln, kein Geld mehr zu haben oder Bier, sich auf wichtige Absprachen mit zugedröhnten Freunden nicht verlassen zu können, Angst vor merkwürdigen Träumen (die sie oft zu Kurzgeschichten verarbeitet) oder den Blicken anderer, überhaupt Angst, sich alleine in der Öffentlichkeit zu bewegen, weil jederzeit ein epileptischer Anfall kommen kann.
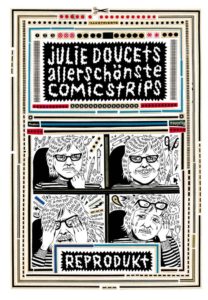
„Julie Doucet (Autorin und Zeichnerin): Julie Doucets allerschönste Comicstrips“.
Aus dem Englischen von Jutta Harms. Reprodukt, Berlin 2020. 168 Seiten. 20 Euro
Der britische Kulturtheoretiker Mark Fisher schrieb 2014: „Wir bewegen uns ständig im Langweiligen, aber unser Nervensystem ist so überreizt, dass wir nie den Luxus haben, uns zu langweilen.“ Sich im künstlerischen Feld zu langweilen, heißt heute prokrastinieren und wäre kaum ohne eine Zwischenmeldung auf Instagram geduldet, und wenn man eh schon mal da ist… Das digitale Stahlgewitter lähmt das innere Chaos durch Content-, Diskussions- und Ablenkungszwang, alle sind allein, weil niemand allein ist. Bei Doucet spiegelt sich das innere Chaos, dem zumindest noch geordnete Panels gegenüberstehen, in der Unordnung der Räume: Der Boden und die Tische sind übersät mit Gegenständen, viele Panels sind geradezu Wimmelbilder. Das sind keine Regenerationsorte jenseits des draußen tobenden Grauens. Wenn die herumliegenden Stifte, Tassen, Bügeleisen und Flaschen zum Leben erwachen und die Zeichnerin beschimpfen, wird auch das Vertraute zur Gefahrenquelle. Allein, Doucet ignoriert sie lässig.
Diese groteske Stimmung unterstreichen die Zeichnungen, besonders der intensive Schwarzeinsatz. Possierliche Figuren mit weiten Augen und übergroßen Köpfen blicken dich herzlich an. Aber das Schwarz um sie herum wirkt unheimlich, die weißen Stellen scheinen die Figuren in einen Lichtkegel zu tauchen, den sie besser nicht verlassen sollten – visuelle Habachtstellung für die Leser*innen, weil jederzeit die Traumstruktur wieder auf den Plan treten könnte oder einfach eine harmlose Gesprächssituation zu kippen droht. Schnell wird es unbehaglich, und das liegt meist an den männlichen Figuren. Es wird heftig gemansplaint, als es dafür noch gar keinen Begriff und nur wenig Bewusstsein gab. Die Typen drängen sich in Doucets Bude, vereinnahmen sie mit scheinheiligen Suizidankündigungen, obwohl sie in derselben Nacht einen Abgabetermin einhalten muss, oder beginnen bei der ersten Begegnung den Smalltalk mit sexualisierenden Spitzen: „Weißt du, ich bin in Ordnung, ich krieg ihn noch hoch, kein Problem!“ Doucets längster Comic „New Yorker Tagebuch“ (in dieser Edition leider nicht enthalten), in dem sie von ihrem Umzug von Montreal nach New York in die Bruchbude ihres Partners, einem erfolg- wie ambitionslosen Comiczeichner, erzählt, zeigt das Paradebeispiel eines toxischen Beziehungsverlaufs: Je mehr Doucet als Künstlerin reüssiert, desto rasanter wächst sein Neid und mit ihm die Kontrollsucht bis hin zur Torpedierung ihrer Arbeit.
Julie Doucets Comics sind keine ergebnisoffenen Gesprächsangebote, sondern feministische Kampfansagen ohne Triggerwarnung, weil es die Freiheit braucht, Scheiße ohne Rücksichtnahme abzubilden. In jeder Seite steckt der Esprit der riot grrrls. Das rief schon in den Neunzigern Kritik hervor, als einige Shops Doucets zunächst selbstverlegte, dann vom kanadischen Indieverlag Drawn & Quarterly herausgegebene Heftreihe „Dirty Plotte“ (Plotte ist in etwa das frankokanadische Pendant zu cunt) wegen Obszönität und Gewalt gegen Frauen (die in keiner der Storys zu finden ist) aus dem Sortiment genommen haben. Zu Beginn der Nullerjahre wandte sich Doucet endgültig vom Comic ab. Das fühlt sich 20 Jahre später kein Stück besser an.
SVEN JACHMANN (Dieser Text erschien zuerst in: KONKRET 6/2020)
„Unerschrocken. Fünfzehn Porträts außergewöhnlicher Frauen“ von Pénélope Bagieu
„Als ob ich Zeit zum Heiraten hätte! Ich hab keine Zeit, einen Mann zu bewundern oder zu bemuttern. Entweder werde ich eine schlechte Ehefrau oder eine schlechte Malerin!“ Das sagte Tove Jansson Ende der dreißiger Jahre ihren Kommilitoninnen, von denen viele ihr Kunststudium gegen ein Leben als Ehefrau eintauschen wollen. Jansson bricht ihr Studium ab, weil sie im etablierten Kunstbetrieb als Frau permanent an den Rand gedrängt wird. Sie gründet ein Künstlerkollektiv, zeichnet in Helsinki antifaschistische Karikaturen, lebt offen in einer lesbischen Beziehung und erfindet die surrealistische „Mumin“-Familie, für die sie später bekannt wird.

Pénélope Bagieu (Text und Zeichnungen): „Unerschrocken. Fünfzehn Porträts außergewöhnlicher Frauen“.
Aus dem Französischen von Heike Drescher und Claudia Sandberg. Reprodukt, Berlin 2017. 144 Seiten. 24 Euro
Dem möchte eine Geschichtsschreibung entgegenwirken, die sich der Vergessenen und Übersehenen annimmt. Eine solche Perspektive nimmt Pénélope Bagieu in ihrem Comic „Unerschrocken“ ein (ein zweiter Band erscheint dieser Tage), in dem die 1982 geborene französische Zeichnerin die lauten und leisen Kämpferinnen der Welt- und Kulturgeschichte aus der Vergessenheit holt. Bereits in ihrem 2016 auf Deutsch erschienenen Werk „California Dreamin’“ hatte sie sich ausführlich mit der Biographie von Cass Elliot beschäftigt. Als Kind jüdischer Einwanderer in Baltimore, Maryland, geboren, musste sich die Sängerin von The Mamas & the Papas die Anerkennung in der Musikszene trotz ihrer stimmlichen Leistungen hart erkämpfen. An diese Beschäftigung mit Biographien marginalisierter oder unangepasster Frauen knüpft Bagieu nun an. Fünfzehn Porträts außergewöhnlicher Frauen hat sie zusammengetragen, und gerade in der Vielfalt der vorgestellten Lebensgeschichten spiegelt sich die Idee, die die Künstlerin umtreibt: Quer durch die Jahrhunderte und Kulturen findet sie Biographien von Frauen, die durch kleine und große Handlungen ihre unmittelbare Umwelt verändert haben. Viele von ihnen erhalten in der großen Geschichtsschreibung nicht den ihnen gebührenden Platz eingeräumt, weil ihre Taten zu marginal erscheinen oder ihnen die Anerkennung bewusst verweigert wird.
Letzteres trifft auf die chinesische Kaiserin Wu Zetian zu. Sie wurde im Jahr 624 unserer Zeitrechnung geboren und war eine Pionierin auf dem Gebiet der weiblichen Geschichtsschreibung. Eine ihrer ersten Amtshandlungen war es, etliche Gelehrte damit zu beauftragen, die Biographien bedeutender Frauen niederzuschreiben, um die Rolle der Frau in der Gesellschaft aufzuwerten. Wu Zetian ist innerhalb weniger Jahre von der Konkubine des Kaisers zu seiner Ehefrau, wichtigsten politischen Beraterin und nach seinem Tod zur ersten und einzigen Frau in der Geschichte Chinas aufgestiegen, die je den Kaisertitel trug. Doch auch in der Erfüllung ihrer politischen Aufgaben setzte die Kaiserin neue Akzente; Bagieu zählt auf: „Ermutigt Bewohner aller sozialer Schichten, sich in der Politik zu engagieren. Um der Vetternwirtschaft ein Ende zu setzen, führt die Kaiserin die Vorstellungsgespräche selbst durch. Außerdem erlässt sie zwölf Dekrete, die die Stellung der Frau in den Bereichen Bildung und Justiz sowie ihren Zugang zu öffentlichen Ämtern stärken.“ In der offiziellen Geschichtsschreibung Chinas wurde Wu Zetian dämonisiert. Der Comic verfährt genau umgekehrt. Während er die positiven Aspekte ihrer Regentschaft betont, vernachlässigt er die Brutalität des kaiserlichen Geheimdienstes.

Pénélope Bagieu (Text und Zeichnungen): „Unerschrocken 2. Fünfzehn Porträts außergewöhnlicher Frauen“.
Aus dem Französischen von Heike Drescher und Claudia Sandberg. Reprodukt, Berlin 2018. 168 Seiten. 24 Euro
Zum Zweiten porträtiert Pénélope Bagieu Frauen, deren Vermächtnis auf den ersten Blick unbedeutend erscheint, die aber dennoch in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld eine enorme Wirkung hatten. Dazu gehören Frauen wie die 1865 geborene Clémentine Delait, die „Dame mit Bart“, die sich mit dem Attraktivitätsideal ihrer Zeit nicht unterwerfen wollte, oder die Australierin Annette Kellerman, die Anfang des 20. Jahrhunderts den ersten Badeanzug für Frauen entworfen hat und einige Jahre darauf als Schauspielerin in Hollywood für einen Boom an Schwimmfilmen verantwortlich war. „Ich habe geholfen, den weiblichen Körper zu befreien“, soll sie gesagt haben.
Und zum Dritten rücken Frauen in den Fokus, die zwar zu Berühmtheit gelangt sind, deren Kämpfe aber verkannt wurden. Die 1902 geborene Schauspielerin Margaret Hamilton etwa, die dem Ratschlag, sich einer karrierefördernden Schönheitsoperation zu unterziehen, trotzte und mit einem der berühmtesten Filme ihrer Zeit, „Der Zauberer von Oz“, zum Hollywoodstar wurde – wenn auch in der Rolle der bösen Hexe. Die wohl berühmteste Frau unter den Porträtierten ist Josephine Baker, die 1925 aus den USA nach Paris kam und dort als Tänzerin Karriere machte. Was jedoch unterschlagen wird, ist die Tatsache, dass sie die erste Schwarze war, die im Kino eine Hauptrolle spielte, und dass sie unter der nationalsozialistischen Besatzung – sie hatte mittlerweile die französische Staatsbürgerschaft angenommen – als Spionin für die Résistance arbeitete. Sie nutzte ihre Prominenz, um an geheime Informationen zu gelangen und diese dem Widerstand zuzuspielen. Nach dem Zweiten Weltkrieg adoptierte sie zwölf Kinder aus aller Welt und engagierte sich in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung sowie der Ligue internationale contre l’antisémitisme. Dafür vernachlässigte Baker sogar ihre Karriere. Sie starb 1975 verarmt an den Folgen eines Schlaganfalls.
Auch wenn die Auswahl der Porträtierten auf den ersten Blick beliebig wirkt, machen Bagieus Blick auf besondere biographische Details und ihre Sympathie für die unerschrockenen Frauen der Weltgeschichte das wieder wett und lassen den Comic zu einer ebenso gewinnbringenden wie unterhaltsamen Lektüre werden. In Frankreich ist Anfang 2017 bereits ein zweiter Band erschienen, der unerschrockene Frauen der Gegenwart in den Mittelpunkt stellt – der Bedarf an Vorbildern ist noch nicht gedeckt.
JONAS ENGELMANN (Dieser Text erschien zuerst in: Jungle World)
„Busengewunder“ von Lisa Frühbeis
Wer bei dem Begriff „feministische Kolumne“ an wütende Kampfreden denkt, wird bei den Comic-Episoden von Lisa Frühbeis, geboren 1987, eines Besseren belehrt. Zwischen 2017 und 2019 erschienen ihre persönlichen Beobachtungen des Alltags monatlich im Sonntagsmagazin des Tagesspiegel. Nun sind sie unter dem Titel „Busengewunder“ bei Carlsen in einem Sammelband erschienen.
Für diejenigen, die sich bisher noch nicht mit Feminismus beschäftigt haben und mit der Ungleichheit zwischen Männern und Frauen noch nicht in Berührung gekommen sind, sind die Kolumnen ein guter Einstieg in die Thematik. Unterhaltsam und witzig geleitet die sympathische Protagonistin die Leserinnen und Leser durch ihren Alltag und macht sie Stück für Stück mit der Position der Frau in der heutigen Gesellschaft bekannt.
In ihren 30 Episoden verbindet Frühbeis geschickt Autobiografisches mit Einblicken zum Beispiel in die Geschichte des Büstenhalters oder das nicht ganz neutrale Gesetzbuch. Sie gibt ihren eigenen Erfahrungen als Frau Raum und verleiht ihnen durch wissenschaftliche Fakten und Studien Tiefe und Relevanz.

Lisa Frühbeis (Autorin und Zeichnerin): „Busengewunder. Meine feministischen Kolumnen“.
Carlsen, Hamburg 2020. 128 Seiten. 15 Euro
Lebendig, leicht und schnörkellos kommen Gestaltung und Aufmachung daher. Jede Kolumne hat ein eigenes Farbschema. Die schwarzweißen Zeichnungen erhalten in der Regel durch zwei Farben Dynamik und Tiefe.
Frühbeis verwendet Farben sparsam, um Unterschiede zu verdeutlichen, zum Beispiel Rosa und Hellblau für weibliche und männliche Genitalnamen oder zur visuellen Abgrenzung von historischen oder juristischen Einschüben. Die Panels sind teils schwarz gerahmt, teils heben sie sich nur durch ihre farbliche Fassung von der Seite ab.
„Busengewunder“ wurde jetzt auch für einen Max-und-Moritz-Preis nominiert, die alle zwei Jahre beim Internationalen Comic-Salon Erlangen vergebene Auszeichnung für die besten Comics aus dem In- und Ausland. Da der Salon in diesem Jahr wegen der Coronakrise ausfallen musste, wird die Preisverleihung am 10. Juli online durchgeführt. Auf der Website des Comic-Salons finden sich alle 25 nominierten Titel für die Auszeichnungen.
Lisa Frühbeis arbeitet als Graphic Recorder, sie fertigt live gezeichnete Protokolle von Veranstaltungen an. Ihr Zeichenstil in den Kolumnen ist dem der Graphic Recordings sehr ähnlich.
Die Figuren und ihre Settings wirken souverän und schnell gezeichnet, kleine Details wie ein Teebeutelschildchen, das aus der Teekanne herausschaut, oder das Petersilienblatt auf dem Teller mit französischen Spezialitäten spiegeln Frühbeis‘ Blick fürs Detail, von dem ihre Kolumnen auch inhaltlich profitieren. Ob es um Beinbehaarung geht, Frauenquote, Gender Pay Gap, die Periode, Kleidungsfragen oder gezeichnete Brüste im Comic – sie schaut sich diese Punkte genauer an und geht zeichnerisch darauf ein.Möglicherweise darauf Bezug nehmend bezieht sie sich bei ihrer Selbstdarstellung auf Laokoon, den „auf das Volk Achtenden“, der der Sage nach als Einziger ahnte, was sich in dem trojanischen Pferd verbarg, und seinen vergleichsweise winzigen Speer auf das riesige Bauwerk warf.
Das Risiko, das Laokoon bei seinem Speerwurf einging, ist in Frühbeis‘ Darstellungen jedoch weniger zu finden. Sie bleibt bei der Betrachtung der kleinen Unstimmigkeiten im Alltag, die sie an der Hand ihrer beinahe niedlichen Protagonistin überaus vorsichtig benennt. Zwar gehen einzelne Blicke etwas näher auf die Geschichte ein oder stellen grundsätzliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Rechtsprechung heraus, doch werden die Themen letztlich nur an der Oberfläche berührt.
Sie geht kaum auf aktuelle gesellschaftliche Diskurse und Ereignisse ein, obwohl der Feminismus durch die #MeToo-Debatte ab 2017 neue Aktualität erlebte. Auch geht es im Feminismus nicht mehr nur um Frauen, wie der Begriff nahelegt, sondern um Menschen jeglichen Geschlechts.
In „Busengewunder“ ist davon jedoch nichts zu finden. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Kolumnen auf autobiografischen Erfahrungen basieren. Doch lässt Frühbeis auch die gesellschaftliche Position von Müttern aus – obwohl Mütter in ihren Darstellungen erscheinen.
„Busengewunder“ bezieht sich somit recht begrenzt auf einzelne Ebenen des Feminismus. Hier zeigt sich, dass eine Kolumne nur einen kleinen Rahmen bietet, in dem ein Thema vorgestellt, vertieft und abgeschlossen werden kann.Lisa Frühbeis bleibt bei aller Persönlichkeit sachlich, das ist angenehm für das Leseerlebnis, allerdings fehlt den Kolumnen auch der Biss, den das Thema Feminismus erwarten lässt. Hier haben bereits vor Jahrzehnten Zeichnerinnen wie Claire Bretécher, Julie Doucet, Bettina Bayerl oder Amelie Glienke alias Hogli – auch in wenigen Bildern – stärker auf alltägliche Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen hingewiesen und Heldinnen jenseits der genormten Vorstellungen gezeigt.
In diesem Zusammenhang wirkt die letzte Kolumne, der „Epilog“, in der es in einem fiktivem Tagesspiegel-Artikel heißt, dass es noch über 217 Jahre dauere (einem realen Tagesspiegel-Artikel zufolge sind es sogar 257 Jahre), bis die Gleichstellung der Frau in Sachen Lohnzahlung hergestellt sei, wie ein Hinnehmen der gegebenen Umstände.
Frühbeis weist zwar darauf hin, dass „die unbewusste, gedankliche Vorprägung“ wissenschaftlich nachgewiesen sei. Dies zeigt auch eine aktuelle Studie, die besagt, dass gerade in Familienunternehmen seltener Frauen in Führungspositionen eingesetzt werden. Enttäuschend sind aber ihre abschließenden Worte: „Noch 217 Jahre. Unsere Prägung aufzulösen ist ein generationenübergreifender Prozess. […] Die nächste Generation wird das sicher besser machen.“
Auch wenn sie in einem Interview mit dem ARD-Campusmagazin sagt, dass das Private immer politisch sei, bleibt in dieser Sammlung von Kolumnen eine tiefergehende Kritik aus. Die Protagonistin arrangiert sich mit ihrer Umwelt, obwohl sie erlebtes Unrecht nicht akzeptieren wollte. Dafür, die Aufgabe an die nächste Generation weiterzugeben, für mehr Gleichheit einzutreten und sich gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung zu wehren, ist sie aber noch zu jung.
RILANA KUBASSA (Diese Kritik erschien zuerst am 27.06.2020 in: Der Tagesspiegel)
„Von unten“ von Daria Bogdanska
„Ein typischer Freitagabend. Manche müssen arbeiten, damit andere feiern können.“ Die Rollen sind ziemlich klar verteilt. Daria gehört zu denen, deren Blick „von unten“ auf die Verhältnisse fällt, sie muss arbeiten, während andere feiern können. Morgens steht die Mittzwanzigerin in aller Frühe auf, um im Auftrag der Stadt Malmö Fahrradfahrer auf dem Weg zur Arbeit zu zählen, geht dann zur Kunsthochschule, wo sie Illustration studiert, um danach bis tief in die Nacht im indischen Restaurant „Curry Hut“ Gäste zu bedienen. In ihrem autobiographischem Comic „Von unten“ erzählt Daria Bogdanska von ihrem prekären Arbeitsalltag.
Die 1988 in Warschau geborene Zeichnerin hat schon mit 15 wegen eines prügelnden Vaters ihr Elternhaus verlassen, in besetzten Häusern gelebt und sich zuletzt in Spanien mit schlecht bezahlten Jobs über Wasser gehalten. „Ich wurde unzählige Male gefeuert. Und immer, weil ich mich gegen die Ungerechtigkeit gewehrt hatte“, fasst sie ihre Erlebnisse zusammen. Im schwedischen Malmö versucht sie einen Neustart. An der Jobmisere ändert der Umzug aber erst mal nichts. Egal, ob im hippen Fairtrade-Café, als Fahrradkurier oder als Verkäuferin – überall sind die Arbeitsbedingungen mies und Kritik wird nicht geduldet.

Daria Bogdanska (Autorin und Zeichnerin): „Von unten“.
Avant-Verlag, Berlin 2019. 200 Seiten. 22 Euro
„Fast niemand in der Curry Hut hat einen Vertrag. Aber das ist nicht das Schlimmste. Leute, die dort schon seit mehreren Jahren arbeiten, bekommen 40 bis 45 Kronen pro Stunde, wenn sie aus Bangladesh sind. Ich bekomme 50, und Ida aus irgendeinem Grund 60“, erzählt Daria ihrem neuen Kollegen Daniel. „Alle im Curry Hut arbeiten schwarz. Der Chef muss keine Steuern abdrücken und zahlt uns Hungerlöhne, die auf unserer Herkunft basieren.“ Gegen diese Praktiken beginnt Daria sich aufzulehnen. „Ich will keine Sklavin sein“, ist nach einem aufreibenden Arbeitstag ihr letzter Gedanke vor dem Einschlafen. Davon angetrieben sucht sie Mitstreiter, tritt in die Gewerkschaft ein, kontaktiert Journalisten und spricht mit anderen betroffenen Migranten.
Der Comic schildert, wie ausbeuterische Arbeitgeber auf die Angst ihrer prekär beschäftigten Mitarbeiter bauen können. „Daria, dass sich hier etwas ändern muss, ist klar. Ich habe es auch satt, so zu leben. Aber leider können ich und die anderen nicht mitmachen, zu riskant. Wir sind alle auf unsere Weise von Sanad abhängig“, erklärt ihre Kollegin Nirja, warum sie Darias Proteste nicht unterstützen kann. Daria dagegen verwandelt sich von einer unsicheren Migrantin zu einer gewerkschaftlich organisierten Kämpferin. Nach Verhandlungen mit ihrem Arbeitgeber, die von der schwedischen Gewerkschaft unterstützt werden, muss der Gastronom ihr den unterschlagenen Lohn auszahlen. Bogdanska erzählt von Kämpfen, die migrantische Jobber in Europa tagtäglich führen. Diese Kämpfe, so macht sie deutlich, kann niemand alleine gewinnen. Ein frustrierter Gewerkschafter fasst die triste Realität so zusammen: „So was endet eigentlich immer gleich. Ihr werdet gefeuert, bekommt vielleicht eine Abfindung und alles geht so weiter wie bisher.“
Doch die Arbeit im „Curry Hut“ ist nicht das einzige Abhängigkeitsverhältnis, aus dem Daria sich befreit. Sie beginnt auch, die Abhängigkeiten in ihrem Privatleben zu hinterfragen. Da ist der Schwede Erik, den sie in Spanien kennengelernt hatte und der ihr geholfen hatte, sich in Malmö zurechtzufinden. Daraus ist eine Art von Liebesbeziehung entstanden. Da Erik auf einem Bauernhof außerhalb der Stadt lebt, sehen die beiden sich nur selten.„Eigentlich gefällt es mir ganz gut, wie es zwischen uns ist. Ohne großen Erwartungsdruck“, verrät sie ihrem vertrauten Freund Mendi. „Aber ich weiß irgendwie nicht. Ich wünschte, ich hätte mal etwas, das bleibt, wie es ist. Jemand, auf den ich mich verlassen kann.“ Daria fühlt sich Erik gegenüber verpflichtet, weil er ihr beim Ankommen in Malmö geholfen hat. Dem leicht depressiven, vor allem aber naiven Erik ist Darias Abhängigkeit ganz recht. Wenn es ihm passt, besucht er sie in Malmö, ruft sie an oder bittet sie, Weihnachten mit ihm zu verbringen. Er nutzt ihre Unsicherheit subtil aus, wenn er vorschlägt, sie zu heiraten, um ihren Aufenthaltsstatus zu festigen. Dazu kommt es nicht. Daria lernt den Punk Krisse kennen und verliebt sich in ihn. Sie trennt sich von Erik und entwickelt auch als Künstlerin immer mehr Selbstbewusstsein.
Der in Schwarzweiß gehaltene Comic schildert die prekäre Lage einer Generation ohne sichere Jobs, das Leben in der Malmöer Underground-Szene und die Sehnsucht der jungen Frau nach einer Perspektive. „Von unten“ erzählt in mehrfacher Hinsicht eine Geschichte der Befreiung – aus Arbeitsverhältnissen, den Abhängigkeiten einer Beziehung und aus der Unsicherheit wegen der eigenen Zukunft. Der Comic versucht, diese verschiedenen Formen von Abhängigkeit in einen Zusammenhang zu bringen. „Alles ist provisorisch, alles ist unsicher. Wir müssen uns immer sagen lassen, unsere Generation sei ›verwöhnt‹. Aber wir sind Produkt und Opfer des Systems, in dem wir leben: im Kapitalismus“, erklärt die Zeichnerin in einem Interview ihre Arbeit.
Diese Ambivalenz, gleichzeitig Produkt und Opfer des Kapitalismus zu sein, spiegelt sich auch in einem Subtext des Comics: der politischen Punkszene, von der Daria geprägt ist. Die Subkultur steht nicht im Vordergrund, gibt dem Album aber durch Poster, Konzerte und Bandshirts einen roten Faden. „Das Kapital erhöht die Mieten und der Staat das Wohngeld, so kann man das eiserne Lohngesetz hintergehn“, singt eine schwedische Punkband im Comic. Die gleichen Widersprüche, mit denen Punk sich seit seiner Entstehung in den späten Siebzigern herumschlagen muss, machen auch Daria zu schaffen: So sehr man sich auflehnt gegen das System, die Gesellschaft, den Kapitalismus, so sehr bleibt man doch deren Teil. Antikapitalistische Lyrics und Ideale alleine sorgen nicht für eine freie Gesellschaft. Sie können aber motivieren, im eigenen Umfeld zu einem besserem Leben beizutragen. Dafür bedarf es der Vernetzung und der Solidarität – und der richtige Soundtrack ist auch nicht verkehrt.
JONAS ENGELMANN (Dieser Text erschien zuerst in: Jungle World 29/2019)
„Die dicke Prinzessin Petronia“ von Katharina Greve
Die dicke Prinzessin Petronia wiederspricht geradezu dem Prinzessinnen-Klischee: Sie hasst Rüschenkleider, ist kein bisschen auf der Suche nach einem Traumprinzen, sondern will selbst Herrscherin des Universums werden. Sie hat ständig schlechte Laune und interessiert sch brennend für Naturwissenschaften.
Als Petronia auf ihrem kleinen Planeten einen Einzeller entdeckt, rechnet sie gleich aus, wieviel Jahrmillionen an Evolution es braucht, bis aus so einem Einzeller ein Spielkamerad wird. Und als ihr klar wird, dass daraus möglicherweise auch fiese Angreifer entstehen könnten, tritt sie den possierlichen Einzeller einfach mit der Hacke ihres Schuhs tot – Petronia hat also das Zeug zur Diktatorin.

Katharina Greve (Autorin und Zeichnerin): „Die dicke Prinzessin Petronia“.
Avant-Verlag, Berlin 2019. 104 Seiten. 20 Euro
Und auch der Rest ist reduziert: Petronia steht auf einem winzigen Planeten, der mit seinen hübschen Kratern an den Planeten des kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry erinnert – nur dass der Planet vom kleinen Prinzen deutlich größer ist als der Prinz. Bei Petronia ist das umgekehrt – und das ärgert sie furchtbar.
Tatsächlich ist „Die dicke Prinzessin Petronia“ ein Gegenentwurf zum kleinen Prinzen, und in Katharina Greves Buch ist der kleine Prinz auch noch der Cousin von Prinzessin Petronia, die ihn für einen speichelleckenden Spießer hält, der nix kann außer nett sein. Und dem sie natürlich seinen großen Planeten neidet.
Zu allem Überfluss demütigt ihre Mutter – die Herrscherin des Universums – Petronia mit einem Thronfolge-Praktikum und schenkt ihr auch noch einen dummen Multifunktionswurm zur Gesellschaft, damit sie endlich Ruhe gibt. Darin steckt also viel familiärer Konfliktstoff und das Drama eines hochintelligenten, unangepassten Mädchens.
Die Cartoons, die bislang einzeln in der Zeitschrift „Das Magazin“ und in der Tageszeitung „taz“ veröffentlicht wurden, bleiben auch über die gut 100 Seiten des Buchs spannend. Weil Katharina Greve es ganz wunderbar versteht, den Grundkonflikten immer neue fiese oder lakonische, auf jeden Fall überraschende Pointen zu entlocken. Und weil sie dafür auch Details aus allen Ecken des Weltwissens heranzieht: Schrödingers Katze aus der theoretischen Physik taucht bei Petronia zum Beispiel genauso auf wie Sissyphos aus den antiken Sagen.
Und dann kultiviert sie auch immer wieder einen herrlichen Sprachwitz, bei dem auch die Sprache selbst zum Thema werden kann – zum Beispiel wenn Petronia darüber nachdenkt, dass das Wort „herrschen“ nur ein schwaches Verb ist. „Die dicke Prinzessin Petronia“ ist also eine klare Empfehlung.
ANDREA HEINZE (Dieser Beitrag erschien zuerst am 21.03.2019 auf: kulturradio rbb)
„Skim“ von Mariko und Jillian Tamaki
Als der Exfreund einer Schülerin sich umbringt, bricht an einer katholischen Mädchenschule des Jahres 1993 der Wahnsinn aus: Aus Angst vor Nachahmern überschlagen sich Lehrer und Mitschülerinnen mit gut gemeinten Ratschlägen und Präventionsmaßnahmen. Im Comic „Skim“ von Jillian und Mariko Tamaki erfahren wir davon aus Sicht der 16jährigen Tagebuchschreiberin Skim. „Skim“ war 2008 die erste Zusammenarbeit der Cousinen, die hierzulande bereits durch eine Übersetzung ihres Nachfolgewerks „Ein Sommer am See“ bekannt wurden und seither zu den interessantesten Stimmen der internationalen Comic-Szene gehören.
Den Tagebuchstil setzen sie jedoch ganz anders um, als man ihn etwa kürzlich bei der Amerikanerin Emil Ferris im Comic „Am liebsten mag ich Monster“ gesehen hat. Während sich dort das Gefühl einstellt, das Notizbuch der Protagonistin mit ihren eigenen Aufzeichnungen und Skizzen in der Hand zu halten, gehen in „Skim“ Texte und Bilder unterschiedliche Wege. Vor allem in den großen Splash-Pages zu Beginn der einzelnen Kapitel geben die Textfelder Skims Tagebucheinträge wieder. Die Zeichnungen hingegen illustrieren ihre Erlebnisse aus einer übergeordneten Perspektive, ähnlich wie bei einem auktorialen Erzähler im Roman.

Mariko Tamaki (Autorin), Jillian Tamaki (Zeichnerin): „Skim“.
Aus dem Englischen von Sven Scheer. Reprodukt, Berlin 2019. 144 Seiten. 20 Euro
Im Fall der Tamakis verfasst Mariko die Texte in einer Form, die an Drehbücher für Theaterstücke erinnert. Jillian fertigt im Anschluss die Zeichnungen an. Ihr Stil ist eigen, sehr schwungvoll. Sie experimentiert mit Formen, zeichnet etwa nebeneinander ausgelegte Polaroids statt konventioneller Panels. Dem Schwarzweißstil fügt sie graue Schattierungen hinzu, die den Bildern mehr Textur und Dimension verleihen.
Skim ist eine Figur, wie man ihr weder in Comics noch in anderen Medien ständig begegnet: Eine 16-Jährige mit asiatischen Wurzeln, die ihren Spitznamen verpasst bekommen hat, weil sie eben nicht „slim“ – schlank – ist, die sich für die Hexenreligion Wicca interessiert und sich im Laufe der Geschichte in ihre eigene Englischlehrerin verliebt. Aber solche Figuren sind typisch für die Comics von Jillian und Mariko Tamaki, auch „Ein Sommer am See“ erzählte etwa von zwei Freundinnen, die irgendwo im Übergang zwischen Kindheit und Jugend feststecken.
„Skim“ mag im Vergleich dazu noch nicht ganz so ausgefeilt und umfangreich sein. Die Selbstverständlichkeit, mit denen die Tamakis ihre Figuren zum Leben erwecken, ist aber schon hier zu spüren. Nie beanspruchen sie für sich eine repräsentative Geschichte über die experience einer asiatisch-stämmigen Jugendlichen geschrieben zu haben, mit ihrer Arbeit ein queeres Statement abzugeben oder eine abschließende Meinung darüber zu formulieren, wie eine Schule mit Selbstmordfällen umgehen sollte. Jillian und Mariko Tamaki wissen, dass sie nicht für alle sprechen können. Und so erzählen sie von einer fiktiven und ganz spezifischen Gefühlswelt. Darin kann man sich wiedererkennen oder auch nicht – lesenswert bleibt der Comic so oder so.
KATRIN DOERKSEN (Dieser Beitrag erschien zuerst am 07.06.2019 in: Deutschlandfunk Kultur)
„Pirouetten“ & „West, West Texas“ von Tillie Walden
Gesellschaft ist gefährlich. Das spürt man auf jeder Seite in Tillie Waldens gewaltigem Comicwerk. Man weiß nie, wann die destruktiven Kräfte vollends entfesselt werden, aber meist liegt etwas Unheilvolles in der Luft. Die 1996 geborene Texanerin agitiert nicht in ihren Comics, es geht selten manifest politisch zu. Und doch erzählt jedes Werk vom gesellschaftlichen Druck, der die Figuren zu Entscheidungen und Handlungen drängt, deren Tragweite ein Weitermachen unter den bisherigen Bedingungen unmöglich macht. Waldens Protagonistinnen leben und lieben in Angst, und die Liebe ist zugleich der Lichtblick hinter der poetischen Melancholie der Bilder. Es lohnt sich durchzuhalten, aber in dem Durchhaltewillen steckt bereits der ständige Kampf zwischen Macht und Ohnmacht, und die Figuren laufen auch Gefahr, unter die Räder zu geraten.
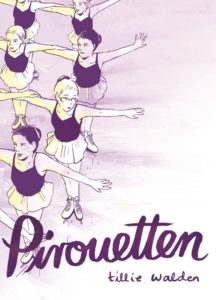
Tillie Walden (Autorin und Zeichnerin): „Pirouetten“.
Aus dem Englischen von Sven Scheer. Reprodukt, Berlin 2018. 400 Seiten. 29 Euro
Waldens 2017 veröffentlichte, 400 Seiten fassende autobiografische Graphic Novel „Spinning“ (auf Deutsch später unter dem Titel „Pirouetten“ erschienen) gewann 2018 den Eisner-Award, den wichtigsten US-Comic-Preis, für den ein Jahr zuvor schon ihr Webcomic „On a Sunbeam“ nominiert war. Letzteren, eine Science-Fiction-Love-Story, die sich durch das Genre mit queerfeministischer Attitüde arbeitet, hat Walden mit Uhrwerkspräzision kapitelweise innerhalb eines Jahres online gestellt. Er kann nach wie vor for free gelesen werden, obwohl First Second Books, ein Verlag der Holtzbrinck-Gruppe, ihn Ende 2018 als über 500seitigen Trumm auf den US-Buchmarkt geworfen hat.
2019 kam, auch in deutscher Übersetzung, mit „West, West Texas“ (im Original „Are You Listening?“) ein 300 Seiten starker Roadtrip in einen imaginären Twin-Peaks-Westen heraus. Der Klappentext verrät, dass Walden gern um acht Uhr abends zu Bett geht. Funktionieren ohne Wenn und Aber scheint die oberste Direktive ihrer Kindheit zu lauten, die Folgen entfaltet sie in ihrer eigenen Coming-of-Age- und Coming-out-Geschichte „Pirouetten“. Waldens Teenagerleben hält der Drill des Eiskunstlaufens fest im Griff: Training vor und nach der Schule, Wettbewerbe, Anpassungs- und Konkurrenzdruck. Desinteressierte (Mutter) wie gutgläubige (Vater) Eltern zwingen sie zur Flucht in die Sprachlosigkeit, von der die erste Liebe wenigstens eine Pause verspricht: „Ich erinnere mich nicht an Schmetterlinge oder ein Gefühl von Freiheit, sondern nur an Angst. Angst, weil ich lesbisch war. Angst, weil wir in Texas waren. Angst vor all dem Hass, den ich aus Youtube-Videos kannte und von dem ich wusste, dass er real war. Aber von meiner Angst, die sich wie ein Eisklumpen in meinem Magen zusammenballte, würde ich mich nicht unterkriegen lassen.“

Tillie Walden (Autorin und Zeichnerin): „West, West Texas“.
Aus dem Englischen von Barbara König. Reprodukt, Berlin 2019. 320 Seiten. 29 Euro
Der Comic ist kein brachiales Road Movie, das die genreimmanente Outlaw-Romantik aufmöbelt, vielmehr eine stille Reise durch die Americana-Topografie. Die latente Tragik hinter diesem gemeinsamen Aufbruch will zwischen den Zeilen in den lakonischen Gesprächen zwischen Bea und Lou registriert werden. Als sie eine entlaufene Katze mitnehmen, um das Tier zum Besitzer ins nirgends verzeichnete West, West Texas zu bringen, entwickelt sich der Trip endgültig zur Seelenlandschaftsodyssee mit David-Lynch-Appeal. Blutrote Wolken drücken vom Himmel herab und verschlingen die Straßen, einsame Hütten hängen vertikal an bebenden Felsen, und zwei unheimliche Männer vom Verkehrsamt für Fernstraßenverwaltung mit merkwürdigem Interesse an der Katze treten als Verfolger auf den Plan. Schließlich entpuppt sich die immer beklemmendere Landschaft als – womöglich – surrealistische Traumaarchitektur und Metapher für eine verletztliche Identität.
Feministische Comics sind derzeit ziemlich gefragt, meist aber in Gestalt von Autobiografien oder Sachcomics. Tillie Walden, die offenbar jedes Genre mit feministischem Bauplan neu zusammenzusetzen versteht und in solch jungen Jahren ein Ouevre hervorgebracht hat, auf das andere Künstler als Lebenswerk stolz wären, ist ein, mit Verlaub, genialer Branchen-Solitär, der später mal, so die Welt durchhält, die Klassikerabteilung am Leben erhalten wird.
SVEN JACHMANN (Dieser Beitrag erschien zuerst in: KONKRET 02/2020)
„Hand aufs Herz“ von Leïla Slimani und Laetitia Coryn
Als Leïla Slimani mit ihrem preisgekrönten Bestseller „Dann schlaf auch du“ in Marokko auf Lesereise geht, trifft sie Frauen die offen über Liebe, Gefühle und Sexualität sprechen und damit ein Tabu brechen – denn das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist in der marokkanischen Gesellschaft nicht vorgesehen. Das Buch, das sie darüber geschrieben hat, ist auch als Comic erschienen. „Hand aufs Herz“ heißt der.
Die Bigotterie der marokkanischen Gesellschaft wird schon in der ersten Begegnung deutlich: Da ist die fast Vierzigjährige, deren Eltern fest daran glauben, dass ihre unverheiratete Tochter noch Jungfrau ist – dabei ist Sex vor der Ehe auch in Marokko üblich – zumindest, wenn man nicht offen darüber spricht: „Sieh dir das da an – da hinten auf dem Felsen. Man sieht es ihnen nicht an, aber sie verstecken sich. Wenn das nicht so bezeichnend für unsere Gesellschaft wäre, würde ich das süß finden.“

Leïla Slimani (Text), Laetitia Coryn (Zeichnungen): „Hand aufs Herz“.
Avant Verlag, Berlin 2018. 108 Seiten. 25 Euro
Immer wieder unterlegt Leïla Slimani die Erlebnisse der Frauen mit Zahlen von NGOs und Gesetzestexten. Etwa den Artikel des Strafgesetzes, nach dem jede Person, die eine Abtreibung herbeiführt, mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft wird. Illegale Abtreibungen kommen die Frauen teuer zu stehen. Im Wartezimmer einer Abtreibungspraxis sitzt ein Querschnitt der marokkanischen Gesellschaft. Eine Frau mit Kopftuch muss wieder gehen, weil sie nicht genug Geld dabei hat: „Was ist aus ihr geworden? Vielleicht musste sie sich prostituieren, um abtreiben zu können – oder noch schlimmer, vielleicht hat sie sich umgebracht?“
Leïla Slimani hat mit einer Ärztin, einer Journalistin, Soziologinnen gesprochen, auch eine Prostituierte ist darunter. Alles Frauen, die mehr oder weniger bewusst für ihre sexuelle Selbstbestimmung eintreten. Und sie erzählt, wie das verhindert werden soll: Es gibt Gesetze, die das Sexualleben justiziabel machen. Und es gibt soziale Kontrolle – durch die Familie, Kollegen, auch Freunde, die die patriarchalen Machtverhältnisse als Normalität verteidigen. Das geht so weit, dass Eltern ihre Tochter verstoßen, wenn die ihren brutal prügelnden Mann verlassen will. Wenn eine Ehe nicht gut läuft, ist die Frau Schuld – und bringt Schande über die ganze Familie.
Zu all diesen schrecklichen Erlebnissen hat die französische Zeichnerin Laetitia Coryn wunderschöne Bilder in leuchtenden Pastellfarben gemalt. Damit erzählt der Comic auch von der atemberaubenden Landschaft Marokkos, von Meer und Bergen und der heiteren Stimmung, die den Alltag durchzieht. Denn das will die marokkanisch-stämmigen Leïla Slimani auch: zeigen, dass die rigiden Moralvorstellungen nur ein Aspekt marokkanischen Lebens sind. Allerdings ein sehr umfassender. Das trifft besonders lesbische Frauen. Viele gehen eine Ehe ein und gründen eine Familie, um nicht aufzufallen. Im Comic erzählt Leïla Slimani von einer Lesbe, die eine solche Scheinehe ablehnt. Offen lesbisch lebt sie aber trotzdem nicht: „Hier in Marokko fühle ich mich immer bedroht – aber ich weiß auch, dass so lange ich mich nicht exponiere, wird niemand bei mir aufkreuzen. In dieser Hinsicht fühle ich mich wie jeder Hetero.“
All das liest sich niederschmetternd. Und doch schafft es Leïla Slimani, die Leser mit einem Funken Hoffnung zu entlassen. Weil sie immer wieder von Frauen erzählt, die trotz aller Repressionen und Selbstzweifel ein selbstbestimmtes Sexualleben führen. Und weil sie ganz zum Schluss auch von einer Frau erzählt, die ihre Kinder ohne Angst vor dem Verlust des Jungfernhäutchens aufwachsen lässt. Sie will nicht, dass ihre Kinder die gleichen Gewalterfahrungen machen müssen wie sie selbst.
ANDREA HEINZE (Dieser Text erschien zuerst auf: Deutschlandfunk.)
„Bei mir zuhause“ von Paulina Stulin
„Es geht natürlich um mich“, erklärt Paulina auf den Stufen vor der Oetinger Villa in Darmstadt einer Bekannten. „Ist aber keine Autobiografie. Fiktion aber auch nicht.“ Das Gespräch dreht sich um den Entstehungsprozess des 600-seitigen Werks „Bei mir zuhause“, das soeben nach sechs Jahren Arbeit erschienen ist. Eine Graphic Novel zwischen Fiktion und Autobiografie von Paulina Stulin, über das „Zuhausesein. Um Rausch. Und ums Dreißigwerden.“

Paulina Stulin (Autorin und Zeichnerin): „Bei mir zuhause“.
Jaja Verlag, Berlin 2020. 612 Seiten. 35 Euro
Die Idee von „Zuhause“ wird im Comic in vielfacher Weise durchgespielt. Da ist zunächst einmal die eigene Wohnung in Darmstadt, seit 13 Jahren das gleiche Dachgeschosszimmer, das sich allerdings „die ganze Zeit mit mir verändert“ hat. In den im Comic erzählten Monaten ist die Wohnung Zufluchts- und Ruheort, kann sich aber schnell in ein Gefängnis transformieren, wenn die Stimmung der Protagonistin zu düster wird, sich vor dem Dachfenster die grauen Wolken sammeln und die Kacheln im Bad die Form eines Gitters annehmen.
„Zuhause“ ist aber auch der eigene Körper, in dem sich Paulina mal mehr und mal weniger wohl fühlt. Sie reflektiert über die gesellschaftlichen Projektionen auf Frauenkörper, auf die Zuschreibungen, unter denen sie leidet. Ihre Versuche, sich der ein oder anderen Erwartung zu entziehen — sich nicht mehr zu rasieren oder das eigene Körpergewicht zu ignorieren —, werden im Comic ebenso inszeniert wie die Schwierigkeiten und das Scheitern. Und ein „Zuhause“ ist die Stadt von Paulina Stulin: Darmstadt. „Bei mir zuhause“ ist eine Hommage an die mittelgroßen Städte wie Darmstadt, an die Vertrautheit und Enge, die gewachsenen sozialen Strukturen, eine intakte Subkultur und die Bedeutung von Orten wie dem Kulturzentrum Oetinger Villa. Orte, an denen man sich kreativ ausleben kann, Party und philosophisches Gespräch nebeneinander möglich sind, Politik und Hedonismus friedlich koexistieren können. Und wo über sechs Jahre hinweg ein Comic wie „Bei mir zuhause“ reifen kann.
JONAS ENGELMANN (Dieser Text erschien zuerst in: Stadtrevue 11/2020)
„Agrippina“ von Claire Bretécher
„Also weißt du, für mich habe ich das Eigentum abgeschafft… Unglaublich, wie mein Leben sich vereinfacht hat, seit ich kein Auto mehr habe…“, erklärt ein rauchender Mann in Claire Bretéchers Comic-Strip „Boheme“. „Und wie bist du hierhergekommen?“, fragt sein Gegenüber. „Mit einem Dienstwagen. Von der Firma. Wenn es nach mir ginge, würde ich überhaupt nur Taxi fahren. Mir liegt gar nichts an Besitz.“ Der Strip aus der Anfangsphase von „Die Frustrierten“ Mitte der Siebziger, der erfolgreichsten Comic-Reihe der 1940 in Nantes geborenen Zeichnerin, fasst Bretéchers gnadenlosen Blick auf das eigene intellektuelle urbane Boheme-Milieu perfekt zusammen. Selbstgerechte Pariser Linke, die ihren materiellen Wohlstand, ihren Sexismus und die eigene Bürgerlichkeit nicht hinterfragen wollen und sich dennoch auf der richtigen Seite wähnen. Sie sei die „Soziologin des Jahres“ hat Roland Barthes 1976 über Bretécher gesagt, die mit genauem Blick gesellschaftliche Milieus beschreibt und linke Debatten abbildet.
Der Weg zu dieser Aufmerksamkeit war für Bretécher, als eine der wenigen Frauen in der Comicwelt, sehr beschwerlich. Als sie 1963 mit einer Zusammenarbeit mit dem Asterix-Erfinder René Goscinny ihre Karriere begann, hatte sie noch allein mit Bretécher signiert, um nicht als Frau identifiziert zu werden, und so die Möglichkeit zu haben, in der Männerwelt des Comics überhaupt wahrgenommen zu werden. Wahrgenommen wurde sie und sie zeichnete 1965 und 1966 für das wichtige belgische Comic-Magazin „Tintin“, 1969 folgte im von Goscinny herausgegebenen französischen Jugend-Magazin „Pilote“ mit „Cellulite“ ihre erste eigene Geschichte um eine frustrierte Prinzessin, die sich auf der Suche nach ihrem Traumprinzen befindet, sich aber zunehmend fragt, warum dies eigentlich ihr Lebensziel sein sollte. Der Ansatz, das eigene Milieu und die damit verbundenen Erwartungen zu hinterfragen, steckt schon in diesem Frühwerk, später wird Bretécher lediglich ein zeitgenössischeres Setting für ihre Gesellschaftskritik wählen.1972 erfolgt der Bruch mit „Pilote“ und Goscinny. Der Chefredakteur hatte einen Strip der Reihe „Le Concombre masqué“ des Zeichners Nikita Mandryka abgelehnt, woraufhin er gemeinsam mit Bretécher und Marcel Gotlib das Magazin verließ. Gemeinsam gründeten sie den Verlag „Éditions du Fromage“ und die Zeitschrift „L’Echo des Savanes“. Das Magazin richtete sich nicht an Kinder und Jugendliche wie noch „Pilote“, sondern hatte erwachsene Leser vor Augen. Stilistisch orientierten sie sich am amerikansichen Underground, der in dieser Zeit nach Europa schwappte und den klassischen europäischen Stil der Ligne Claire á la „Tim und Struppi“ durcheinanderbrachte. Die satirischen Comics, die sich über die Sehnsüchte und Ängste der bürgerlichen Gesellschaft lustig machten, fanden schnell zahlreiche Leser, die Auflage stieg auf über 100.000 Exemplare.
Bretécher hatte mittlerweile ihren eigenen Stil entwickelt, der an europäischen Karikaturen geschult und sehr textlastig war, und mit dieser eigenen Stimme in der Comiclandschaft erhielt sie 1973 die Möglichkeit, für die Wochenzeitung „Nouvel Observateur“ ihre Reihe „Die Frustrierten“ zu entwickeln, die bis weit in die Achtziger erschien, in zahlreiche Sprachen übersetzt und 1982 mit dem Grand Prix des wichtigen Comicfestivals in Angoulême geehrt wurde. Auch in Deutschland wurde Bretécher nun zu einer wichtigen Stimme des feministischen Comics, zu einem Role Model für junge Zeichnerinnen und Zeichner wie Franziska Becker, Marie Marcks oder Ralf König. Die zwischen Selbstzweifel und Selbstgerechtigkeit pendelnden Protagonisten in „Die Frustrierten“ waren auch anschlussfähig für das deutsche Post-68er-Milieu.Auch für ihre letzte große Reihe „Agrippina“ um einen Teenager und deren Alltagsstress, die zwischen 1988 und 2009 erschien, erfand sie noch einmal eine neue Sprache. Während sich die Charaktere in „Die Frustrierten“ meist in Selbstgesprächen ergingen, ihnen weniger am Austausch mit dem Gegenüber gelegen war, als vielmehr daran, die eigene Weltsicht zu verbreiten, muss sich Agrippina gezwungenermaßen mit ihrer Umwelt auseinandersetzen, mit jener Generation nämlich, zu der auch die Zeichnerin selbst gehörte. Die Reihe lebt von den Konflikten zwischen den Generationen und ihren Kommunikationsschwierigkeiten.
2016 wurde Bretécher beim Comic-Salon Erlangen als erste Frau mit dem Sonderpreis für ein herausragendes Lebenswerk ausgezeichnet, in der Laudatio sagte Brigitte Helbling: „Sie war eine Frau, die sich in einer Männerwelt behauptete. Ab den ‚Frustrierten‘ bestimmt der weibliche Blick ihre gezeichneten Lebenswelten. Wie ungewöhnlich das war in einer Zeit, in der Frauen im Comic vor allem als kurvenreiche Pappfiguren auftraten! Wie normal das heute geworden ist!“ In der Tat hat Bretécher mit ihrem Witz und ihrem klaren Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse als wichtiges Role Model für Zeichnerinnen gedient, einer Normalität von Frauen in der Comicwelt, von der Helbling spricht, den Weg bereitet. Die ehemalige „Charlie Hebdo“-Zeichnerin Catherine Meurisse sagt über sie: „Sie ist mein Vorbild und wird es für immer sein.“
JONAS ENGELMANN (Dieser Text erschien zuerst am 13.02.2020 in: Neues Deutschland)










